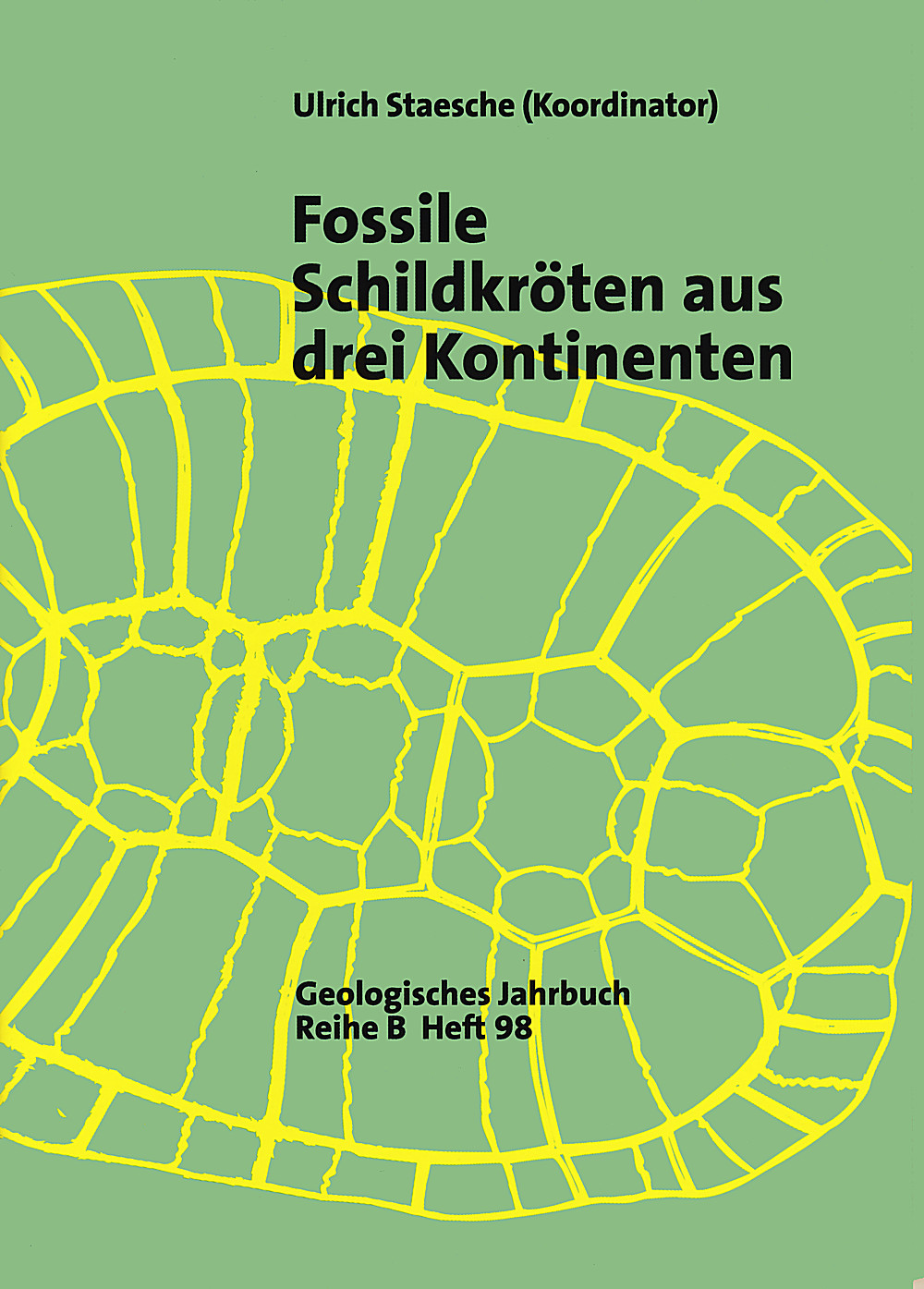Der vorliegende Band enthält unter maßgeblicher Mitwirkung von zwei Autoren
vier voneinander unabhängige Beiträge über Chelonii aus dem Mesozoikum und
Känozoikum.
KARL, H.-V., STAESCHE, U., TICHY, G., LEHMANN, J. & PEITZ,
S. (S. 5-90) behandeln Die Systematik der Schildkröten (Anapsida:
Chelonii) aus Oberjura und Unter kreide von Nordwestdeutschland. Das
Material stammt aus Steinbrüchen im Wiehen gebirge, dem Raum Hannover,
aus einer Baugrube in Hildesheim, dem Langenberg bei Oker, einem
ehemaligen Tagebau am Ith und dem Gebiet Bückeburg- Obernkirchen.
Diese Vorkommen umfassen nahezu lückenlos ein stratigraphisches
Spektrum vom Callovium bis zum Berriasium, mit dem Schwerpunkt der
Funde im unteren, mittleren und oberen Kimmeridgium. Neben klassischem
Fundmaterial aus dem 19. Jahrhundert handelt es sich aber auch um
Reste aus neueren Aufsammlungen. Die Bestände sind auf diverse
Sammlungen verteilt, so dass man in der vollständigen Erfassung eine
bemerkenswerte Seite der Arbeit sehen kann. Bedingt durch das Material
orientiert sich die systematische Abhandlung auf die Ausbildung von
Carapax und Plastron, deren Merkmale an den überwiegend im Abdruck
vorliegenden Exemplaren hinreichend deutlich überliefert
sind. Hauptteil der Arbeit ist gemäß der Zielstellung die
systematische Abhandlung und betrifft von den Pelsiochelyidae
Plesiochelys, Craspedochelys (2 Arten), Tropidemys und eine unbenannte
Form, von den Hylaeochelyidae Hylaeochelys, die Pleurosternidae
Pleurosternon und Desmemys sowie die Peltochelyidae Peltochelys. Alle
Taxa sind formal mit Typus, Diagnose, Bemerkungen und Belegmaterial
abgehandelt. 11 Foto tafeln dokumentieren umfangreiches
Belegmaterial. Die größte Diversität mit jeweils 4 Arten kennt man aus
dem unteren Kimmeridgium und aus dem Berriasium. Eine nähere
Neubeschreibung erfährt der Holotypus von Hylaeochelys (Emys) menkeli
(F. A. ROEMER, 1836), untersetzt durch umfängliches Referenzmaterial
aus dem oberen Kimmeridgium vom Ith und dem Berriasium der
Bückeberge. Die kurze Einschätzung zur Lebensweise interpretiert die
beschriebenen Schildkröten als Bewohner küstennaher Meeresbereiche und
der Mündungen größerer Flüsse.
2) STAESCHE, K., KARL, H.-V. & STAESCHE, U. (S. 91-150) beschreiben
Fossile Schildkröten aus der Türkei, wobei man das Belegmaterial im
Rahmen von Prospektionsarbeiten fand, die 1965 bis 1975 zwischen der
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe und dem staatlichen
Institut für Lagerstättenforschung der Türkei erfolgten. Die Bestände
stammen aus einer Vielzahl Fundstellen im Miozän und Pliozän in erster
Linie des westlichen Anatolien. Beschrieben sind Testudinidae mit der
eurasiatischen Riesen-Landschildkröte Cheirogaster sp. cf. bolivari
und der maurischen Landschildkröte Testudo sp. cf. graeca, Emydidae
mit der kaspischen Bachschildkröte Mauremys sp. cf. caspica und der
europäischen Erdschildkröte Clemmydopis cf. turnauensis sowie
Trionychidae mit der afrikanischen Weichschildkröte Trionyx
triunguis. Für die paläökologische Interpretation der Taxa ziehen
Verf. die bekannten Befunde aus den rezenten Vorkommen heran. 3
Fototafeln dokumentieren Material zu Cheirogaster; die anderen Formen
sind auf schwarzweißen Zeichnungen im Text dargestellt.
3) Im Beitrag von KARL, H.-V. & STAESCHE, U. (S. 151-170) über Fossile
Schildkröten- und andere Wirbeltierreste aus holozänen Seeablagerungen
in der heutigen Sahara fand eine Arbeitsgruppe der Bundesanstalt für
Geowissenschaften und Rohstoffe in den Jahren 1971 bis 1973 bei
Prospektionen in der Republik Niger das bearbeitete Fundmaterial. Die
betreffenden Vorkommen liegen in holozänen Seeablagerungen mit einem
absoluten Alter von knapp 4.000 Jahren. Alle Belege beschränken sich
auf fragmentarische Panzerplatten der pelomedusiden Peluosis sp. und
der trionychiden Cyclanorbis sp., dargestellt auf einer Fototafel.
4) KARL, H.-V. & STAESCHE, U. (S. 171-190) beschreiben Fossile
Riesen-Landschildkröten von den Philippinien und ihre
paläogeographische Bedeutung, die auf die Suche bzw. Exploration von
Kohlevorkommen durch Geologen der Bundesanstalt für Geowissenschaften
und Rohstoffe auf der Insel Luzon zurückgehen, und zwar in den Jahren
1982 bis 1987. Die wenigen Fragmente, ein Humerus, zwei Coracoide, ein
Femur, Phalangen der Vorderextremität, dermale Ossifi kationen und
eine Peripheralplatte sind nach Vergleichen mit Arten der Testudinidae
aus Südostasien die Grundlage für Manouria sondraai n. sp. Der
Fundhorizont liegt in der Laguna-Formation des basalen
Pleistozän. Dieser erste Beleg einer Riesenlandschildkröte auf der
betreffenden Insel veranlasst Verf. zu Betrachtungen der Besiedlung
des südostasiatischen Archipels mit Landwirbeltieren. In Abhängigkeit
von Absenkungen des Meeresspiegels im Pleistozän kann man Landbrücken
zur Ausbreitung festländischer Populationen postulieren. Schildkröten
wie Manouria konnten aber solche Bereiche nur mit kleinwüchsigen Arten
überwinden, so dass die vorliegende Riesenform erst danach
entstand. Gleiche Tendenzen zeigen Verf. für andere
Riesen-Landschildkröten in Südostasien auf.
H. HAUBOLD
Zentralblatt Geol. Pal. T. II, Jg. 2009/5-6