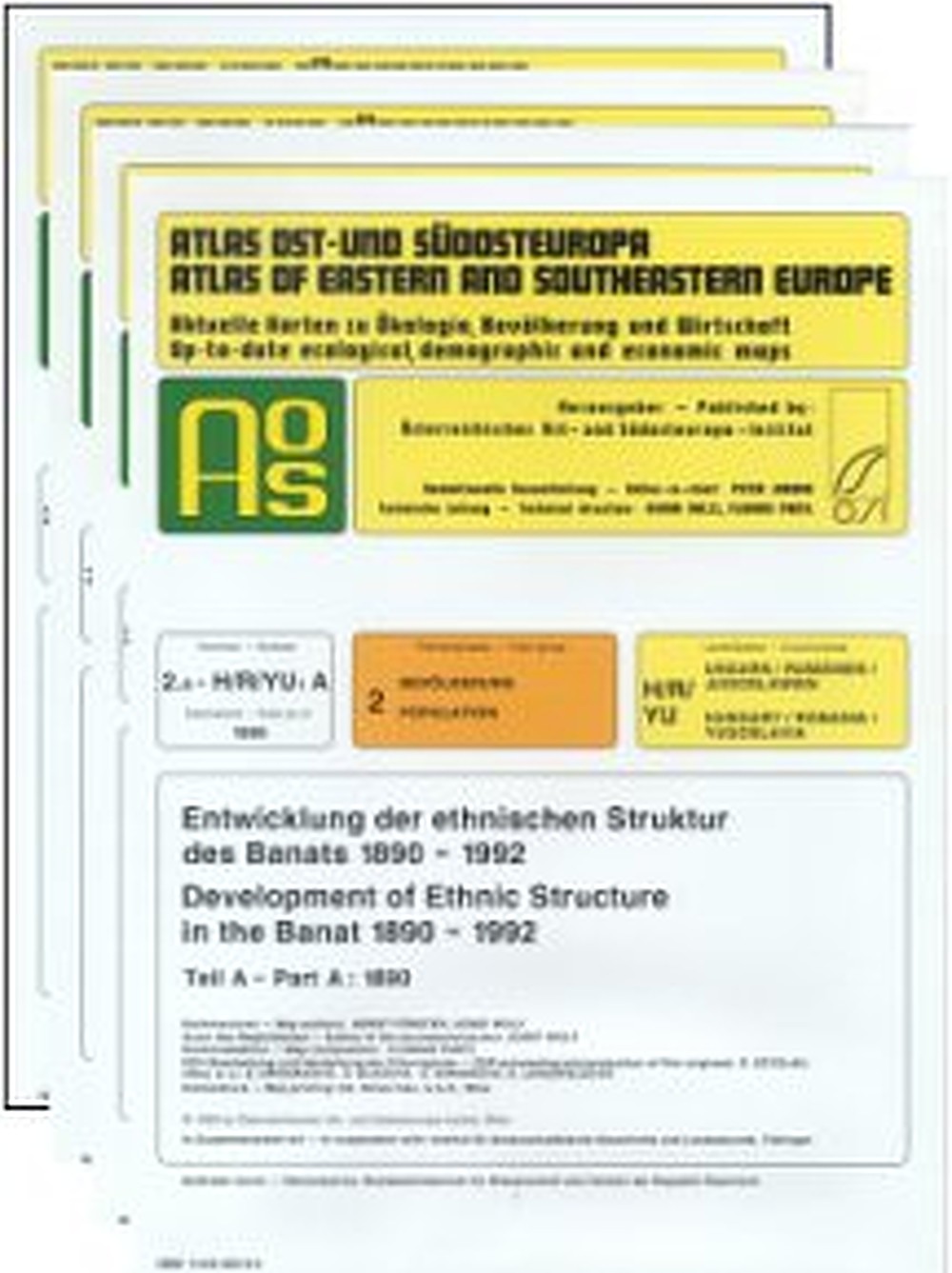Das Banat, seit der Zeit der Donaumonarchie Lebensraum von Angehörigen
vieler Völker infolge der amtlichen Besiedlungspolitik nach dem
Rückzug der osmanischen Herrschaft im ausgehend 18. Jahrhundert, ist
wegen des Ausgangs des Ersten Weltkriegs dreigeteilt: Der größere Teil
liegt auf rumänischem Boden, die beiden kleineren Teile gehören zu
Ungarn und Serbien. Rumänen, Ungarn, Serben und Deutsche bilden die
vier größten ethnischen Gruppen. Daneben gibt es noch eine Reihe
anderer: Ostslawen (Ruthenen, Rusinen), Westslawen (Slowaken,
Tschechen), Südslawen (Kroaten, Bulgaren, Kraschowaner), Italiener,
Zigeuner (Roma, Sinti) und weitere. Allerdings haben sich die
zahlenmäßigen Größenverhältnisse zwischen den Gruppen im 20.
Jahrhundert im Wesentlichen als Folgen der beiden Weltkriege und des
Zusammenbruchs des sozialistischen Ostblocks stark verändert. Trotz
dieser Vorgänge zeigt auch heute noch der rumänische Teil des Banats
eine große ethnische Vielfalt. Eingeschränkt gilt dies auch für den
serbischen Teil, nicht jedoch für den ungarischen, der vergleichsweise
ethnisch homogen strukturiert ist, d.h. weitgehend nur von Ungarn
besiedelt ist.
Die Ergebnisse dieser und noch weiterer Vorgänge und Sachverhalte,
d.h. die räumlichen Verteilungsmuster der ethnischen Gruppen, werden
in vier Karten des Atlasses Ost- und Südosteuropa festgehalten, und
zwar für die Zeitpunkte bzw. Zeiträume 1890, 1930/31, 1949/53/56 und
1990/91/92. Bei dieser Dokumentation handelt es sich um eine besonders
beachtliche Leistung hinsichtlich der Informationen, die für sie
gesammelt wurden, und ihrer kartographischen Präsentation. Sie ist
eine große Hilfe, ja unverzichtbar für alle Historiker, Geographen,
Demographen, Ethnologen, Linguisten und andere Fachwissenschaftler,
die sich mit der Geschichte und Landeskunde des Banats befassen.
Besonders hervorzuheben sind auch die methodischen Reflexionen von
Peter Jordan über die Kartographie, die dem Begleittext vorausgehen.
Den Kartenautoren ist es gelungen, die Verzerrungen der Daten, die
dadurch zustande kamen, dass Volkszählungen verschiedener Staaten
verwendet werden mussten, und dass sie sich auf verschiedene Zeiten
beziehen, durch umsichtige Interpretationen der Quellen zu minimieren.
In diesem Sinne wurde auch der Diagrammmethode in den Karten der
Vorzug gegeben. Als Hauptmerkmal der ethnischen Zuordnung wurde die
Sprache verwendet.
Höchst verdienstvoll ist ebenso die Erarbeitung des Begleittextes
durch Josef Wolf. Die Darstellung geht weit über eine
Karteninterpretation hinaus. Behandelt werden die politische
Geschichte des Raumes, die Demographie, die Migrations-, Siedlungs-
und Kolonisationsprozesse, interethnische Kontakte und Konflikte, die
Regionalentwicklung, die Geschichte der einzelnen ethnischen Gruppen
und anderes mehr. Problematisch werden aber die Ausführungen dann,
wenn mit modernen Begriffen wie ,Raumvorstellungen’ und
,Regionalbewusstsein’ auf historische Sachverhalte eingegangen wird,
auch wenn dies in der Literatur zuweilen anzutreffen ist. Selbst bei
noch so viel Aufwand an Literatur- und Quellenauswertung bleibt
unklar, wie im Nachhinein z.B. Regionalbewusstsein festgestellt werden
kann.
Jedoch soll mit dieser kritischen Anmerkung die enorme Leistung des
Verfassers nicht geschmälert werden, auch nicht mit dem Hinweis
darauf, dass an manchen Stellen lange Schachtelsätze die Lektüre etwas
beeinträchtigen.
67 Tabellen, ein voluminöses Register (etwa 140 Seiten) sowie ein etwa
ebenso umfangreiches Quellen- und Literaturverzeichnis ergänzen dieses
wichtige Werk.
Wilfried Heller
Erdkunde Band 61 Heft 1