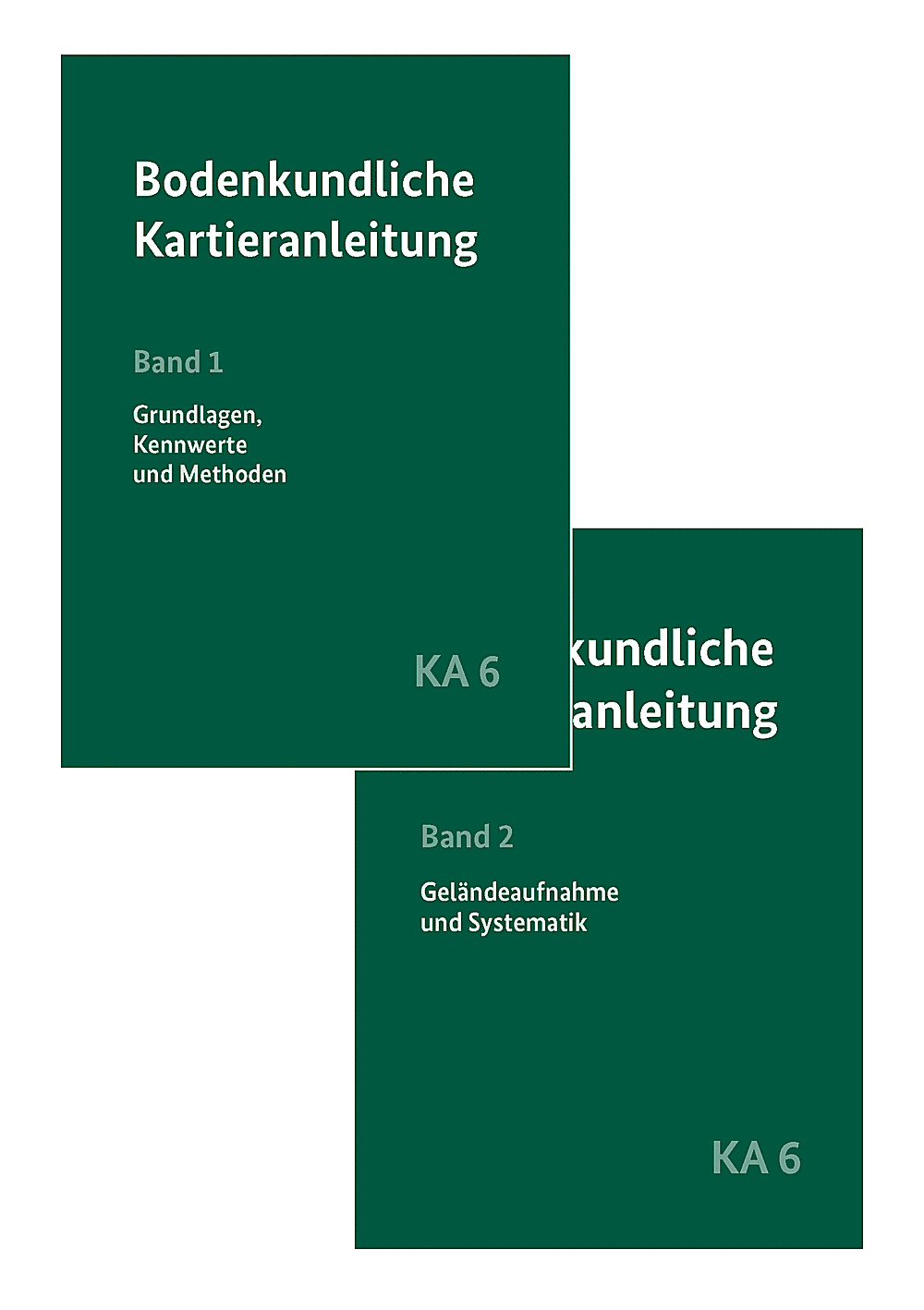Inhaltsbeschreibung top ↑
Die Bodenkundliche Kartieranleitung ist die verbindliche Anleitung zur Bodenkartierung und die Erhebung von Bodendaten in Deutschland. Seit dem Erscheinen der KA5 im Jahr 2005 haben sich die Anforderungen an die Bodenkundliche Kartieranleitung stark gewandelt (unter anderem durch das Geologiedatengesetz, die Mantelverordnung und die neu gefasste Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung). Auch die rasante Entwicklung der Informationstechnologie und der digitalen Datenverarbeitung ermöglichen die anwenderorientierte Auswertung komplexer bodenkundlicher Informationen.
Bestehende datenfeldbezogene Schlüssellisten wurden erweitert und an den aktuellen Datenbedarf angepasst. Bei den jeweiligen Datenfeldern wurden Zusatzinformationen wie Erscheinungsform, Ausprägungsgrad, Flächenanteil sowie Größe aufgeführt und, wo nötig, mit schärferen Definitionen versehen, um die Vollständigkeit und damit Qualität der erhobenen Daten zu verbessern. Piktogramme markieren die obligatorischen Datenfelder für verschiedene Aufnahmezwecke, u. a. der bodenkundlichen Landesaufnahme und der bodenkundlichen Baubegleitung. Deutlich erweitert wurden die Kapitel zur Bodenkartierung.
Die Definition der Horizontsymbole wurde auf diagnostische Kriterien umgestellt. Die Bodensystematik wurde zur Vermeidung von Überschneidungen und Lücken zwischen den bodensystematischen Einheiten von der Angabe ganzer Horizontabfolgen auf die Nennung diagnostischer Horizonte umgestellt, die nun eine leichtere Einordnung eines Bodens in die Systematik ermöglichen. Weitere Änderungen und Ergänzungen betreffen die Einführung neuer Bodentypen, wie z. B. des Andosols oder die durch Degradierungsprozesse im Zuge jahrzehntelanger Nutzung entstandenen Moorfolgeböden als „Abmoor“-Subtypen hydromorpher Böden.
Um den Gebrauch der Substratsystematik zu erleichtern, wurde neben einzelnen Vereinfachungen eine kompaktere Darstellung gewählt. Dies soll die Aufnahme und Kennzeichnung von besonders substratdominierten Böden erleichtern, insbesondere auch auf Siedlungs-, Industrie- und Gewerbeflächen.
Neu ist die Möglichkeit der Beschreibung von Humushorizonten und die Fassung der Humusformen in einer eigenen Systematik.
Auf Wunsch vieler Nutzerinnen und Nutzer wurden die Inhalte der KA6 entflochten. Die KA6 erscheint aus praktischen Gründen in zwei Bänden, einem Grundlagen-, Kennwerte- und Methodenband einerseits und einem Geländeband mit aktualisierten Schlüssellisten zur Bodenaufnahme, Boden- und Substratsystematik, Erläuterung des Modells der periglaziären Lagen sowie der Humusformensystematik andererseits.
Die Bodenkundliche Kartieranleitung ist seit Jahrzehnten auch eine wesentliche Grundlage für die Bodenfachinformationssysteme der Staatlichen Geologischen Dienste. Sie soll sowohl den Austausch von Bodendaten zwischen Bereitstellern und Nutzern als auch zwischen EDV-Systemen vereinfachen und die Verfügbarkeit sowie den Nutzen dieser Daten erhöhen. Die Tabellen für die Datenauswertung, insbesondere zum Bodenwasserhaushalt, wurden auf neuer Datengrundlage komplett überarbeitet und Dreiecksdiagramme zur Abschätzung von Wasserhaushaltsparametern im Gelände ergänzt. Die neue Kartieranleitung wurde von den Staatlichen Geologischen Diensten, der BGR und Arbeitsgruppen wissenschaftlicher Fachgesellschaften (Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft, Gesellschaft für Moor- und Torfkunde) erarbeitet.