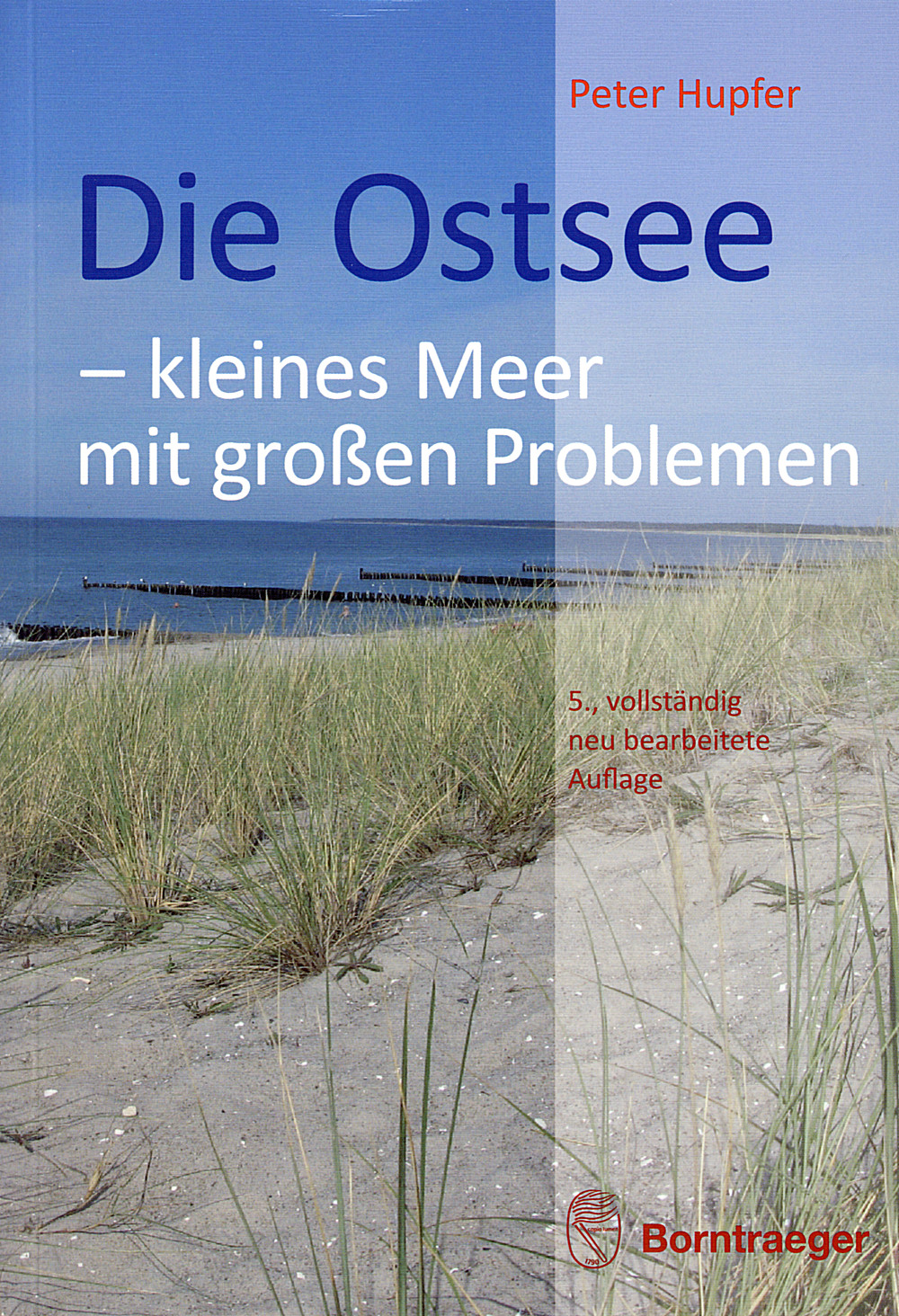Das Buch des Meteorologen PETER HUPFER war zuletzt 1984 in vierter
Auflage in der Reihe Kleine naturwissenschaftliche Bibliothek als Band
40 bei Teubner in Leipzig erschienen und umfasste damals 152
Seiten. Inzwischen veränderte sich, insbesondere nach der politischen
Wende in Europa und dem globalen Klimawandel, auf dem Gebiet der
Meeresforschung rund um das Mare Balticum ziemlich viel. Dass man dem
Rechnung trägt und dabei zugleich auf den breiten Fundus dieses frühen
Werkes zurückgriff, ist nicht nur dem Autor zu verdanken, sondern auch
dem Verlag Borntraeger.
In einer an den Anfang gestellten, recht nützlichen Übersichtskarte
mit den Ostsee- Anliegerländern, wichtigen Städten und den
hauptsächlichen Teilgebieten des Meeres stört die im Skagerrak
eingezeichnete und nordsüdlich verlaufende, rein theoretische Grenze
zwischen Nord- und Ostsee. Später im Text (z. B. S. 56 und S. 58) wird
dann auch an entsprechender Stelle mehrfach darauf hingewiesen, diese
Grenze zwischen den Meeren sei korrekter durch die
Salinitätsunterschiede sowie durch Fauna- und Floragrenzen zu
definieren und läge südlich des Kattegats in der Beltsee.
Die Ostsee ist in ihrer heutiger Form – geologisch betrachtet – mit
einem Alter von ca. 7.000 Jahren ein extrem junges Meer. Seine
Weiterentwicklung hält weiter an, auch ohne die zusätzlichen mehr oder
weniger großen Entwicklungen, die der Mensch verursachte. Zudem ist
dieses relativ kleine Meer mit seinen vielgestaltigen Meeresarmen,
Buchten, Bodden und Haffs von ganz unterschiedlichen Küsten umgeben,
besitzt ein vielfältiges Bodenrelief und ist durch zeitlich,
mengenmäßig und – besonders was den Salzgehalt betrifft – durch sehr
unterschiedliche und stark schwankende Zuflüsse geprägt. Man erfährt
ganz nebenbei, das gesamte Einzugsgebiet der ins Meer mündenden Flüsse
entspräche der fünffachen Fläche Deutschlands. Demgegenüber finden
größere Salzwassereinströmungen von der Nordsee nur unter ganz
bestimmten seltenen Bedingungen statt. Dadurch kommt den verschiedenen
Belastungen eine große Bedeutung zu, die durch Kriege und deren
ökologische Folgen, durch politisch, ökonomisch und technologisch sehr
unterschiedlich geprägte Anrainerstaaten begründet waren und teilweise
noch immer sind.
Wenn dann noch die wechselvollen natürlichen Einflüsse zu beachten
sind – die unterschiedlichsten Wetterlagen und Windrichtungen mit den
entsprechenden Wellensystemen und Sturmhochwassern, die zwar sehr
gemäßigten aber nicht ganz zu vernachlässigenden Gezeiten und die
komplexen durch unterschiedlichen Salzgehalt bedingten
Wasserschichten, ferner lokale Turbulenzen, Oberflächen- und
Tiefenströmungen sowie die noch immer wirksame nacheiszeitliche
Landhebung Skandinaviens – gerät die umfassende Beschäftigung mit dem
Thema Ostsee schnell zu einem komplexen und sehr umfangreichen
Forschungsthema und sogar zu einem anspruchsvollen Modell für die
gesamte Meeresforschung.
Die einzelnen Themen reichen von der Geologie, über Flora und Fauna,
Einflüsse des Menschen, Nutzung der Ostsee durch Fischerei,
Lagerstätten, Gütertransport und den Tourismus, die aktuellen
Umweltgefahren und den heutigen international erfolgreich
kooperierenden Umweltschutz bis hin zur modernen regionalen
Klimatologie für das 21. Jahrhundert. So ist auch dieses
aktualisierte und thematisch hoch interessante Buch als modellhaft zu
bezeichnen, trotz zahlreicher (Schreib-)Fehler, die sich immer noch
darin finden.
Als Hauptgefahr für die Ostsee wird auf der Seite 158 im Abschnitt
Stagnation und Sauerstoffschwund „… eine ungesunde heftige
Lebensentwicklung auf der einen Seite, fortschreitende Stagnation in
der Tiefe auf der anderen Seite.“ resümiert. Für einen mit der Ostsee
weniger vertrauten Leser mag die Aussage zum Benthos in den tiefen
Becken der Ostsee sehr beunruhigend und aufrüttelnd sein: „Die
Lebensgemeinschaften, die bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts dort
existierten, sind teilweise verschwunden. Neubesiedlungen aus
flacheren Gebieten sind … oft nur von kurzer Dauer …“
Das neue und umfangreiche Kapitel 10 Die Ostsee im Klimawandel liefert
zahlreiche Abbildungen und Tabellen mit Messdaten aus unterschiedlich
langen Zeiträumen und stellt Prognosen aus rechnermodellgestützten
aktuellen Forschungsarbeiten zur Verfügung. Man muss lobend die
Bemerkung erwähnen, die Zuverlässigkeit derartiger Prognosen sei nur
mit großer Vorsicht und Zurückhaltung zu bewerten. Es bleibt auf
diesem Gebiet noch viel zu tun.
Das letzte Kapitel widmet sich kurz der Geschichte der
Ostseeforschung, angefangen mit Untersuchungen durch ALEXANDER VON
HUMBOLDT im Sommer 1834, über die, selbst im „Kalten Krieg“,
erfolgreich wirkende Gdańsker Konvention der Anliegerländer von 1973
zum Umweltschutz und der Helsinki-Kommission von 1992 bis zur
aktuellen Ostsee- und Küstenforschung in Deutschland.
Leider ist das eineinhalbseitige Literaturverzeichnis äußerst mager
ausgefallen, und selbst die zahlreich erwähnten und genutzten
Veröffentlichungen anderer Autoren sind im Literaturverzeichnis nicht
zu finden. Lobend zu erwähnen ist, dass sowohl für Einsteiger in die
Naturwissenschaften als auch für „Langgediente“ die kleine Liste der
Vorsätze zu Maßeinheiten von Peta- = 1015 bis Atto- = 10-18 hin und
wieder von Nutzen sein wird. Sehr bedauerlich ist jedoch das Fehlen
eines Glossars der wichtigsten Fachbegriffe.
Wie aus Abb. 1.2 Grundzüge der Tiefenverteilung sowie Angaben zu den
Küstenformen zu entnehmen ist, bestehen weite Teile der westlichen,
südlichen und östlichen Küsten aus Glazialschutt
(Glazialschuttküsten). Man findet deshalb dort an vielen Stellen sehr
aktive Kliffs mit kaum beherrschbarem, starken Küstenrückgang und
immer wieder auch interessanten Geschieben, die heute noch von
Bedeutung für die Petrographie der Gesteine am Grund und rund um die
Ostsee sind, und ebenso für die Paläontologie vom Kambrium bis ins
Paläogen. Dieser letzte Aspekt und der Begriff Geschiebe wurde vom
Autor auch im Abschnitt Näheres über den Sedimentteppich nicht
erwähnt, obwohl dort von Steinen, Blöcken und Geschiebemergel die Rede
ist.
Leider gibt es aber auch zahlreiche Schreibfehler. Man erhält
zunehmend den Eindruck, Buchrezensenten müssten wohl immer häufiger
einen gründlichen Lektor ersetzen! So steht in Abb. 1.1, S. 12
Göteburg, im Text S. 13 korrekt Göteborg. Nur mit Mühe und bei bester
Beleuchtung lassen sich bei den eingezeichneten Küstenlinien in
Abb. 1.2 die in der Legende dargestellten insgesamt 7
unterschiedlichen Grautöne unterscheiden. In Tab. 1.3 Entwicklung der
Ostsee sollte man beim Limnaea- und Mya-Meer statt 500 v. h. besser
1500 v. Chr. schreiben, um so auch den zeitnahen und kulturellen
Zusammenhang zu verdeutlichen. In Abb. 1.10 liest man Gottlandbecken
statt Gotlandbecken. Die in der Beschriftung von Abb. 2.1 angegebenen
blauen und roten Linien sind nicht eingezeichnet, bzw. nicht zu
erkennen. Nach Ansicht des Rez. sind außerdem aktuelle
verfassungsrechtliche Bezeichnungen von Ländern wie Tschechische
Rep. und Slov[sic!]akische Rep. in diesem geographischgeologischen
Zusammenhang unpassend. Konsequenterweise dürfte dann auch der
nördliche Teil des ehemaligen Ostpreußens nicht einfach Russland
heißen! Weiter S. 52: „Der Salzgehalt ausgedrückt in PSU (Practical
Salinity Unit), was etwa gleichbedeutend ist mit 1 g (die 1 fehlt
hier) Salz je kg Meerwasser“. In der zugehörigen Tab. 2.3 muss man
sich bei zahlreichen Dichtewerten zwischen PSU 10 bis PSU 25 jeweils
1,00 bzw. 1,0 vor die angegebenen hinteren Stellen gesetzt denken. Das
ist schon eine sehr eigenwillige Form von Sparsamkeit! Beim Betrachten
der Tab. 6.2 muss einem erst einmal klar werden, dass mit z. B. 9.1,
9.2, 26.12 oder 8.3 die Kalendertage 09.01., 09.02., 26.12. und
08.03. gemeint sind. Und schließlich sind in Abb. 8.5 mit
Verbreitungsgrenzen ausgewählter Pflanzen und Tiere in der Ostsee den
im Finnischen Meerbusen eingezeichneten roten und blauen Linien,
anders als im übrigen Teil der Ostsee, keine Arten zugeordnet, und aus
einer Analogiebetrachtung der farblichen Reihenfolge der Linien sind
die bis dort vorkommenden Arten leider auch nicht rekonstruierbar.
Es ist alles in allem ein sehr lesenswertes Buch für diejenigen Leser,
die sich anhand der Situation der Ostsee einen Überblick über heutige
Probleme der Meeresforschung verschaffen wollen. Der Autor beleuchtet
ein breites Spektrum von Forschungsthemen. Gerade weil die Ostsee ein
so vielfältiges und interessantes Meer ist, kann das Buch als
einführendes Lehrbuch seinen Platz finden.
G. SCHÖNE
Zentralblatt für Geologie und Paläontologie Teil II Jg. 2011, Heft 1/2