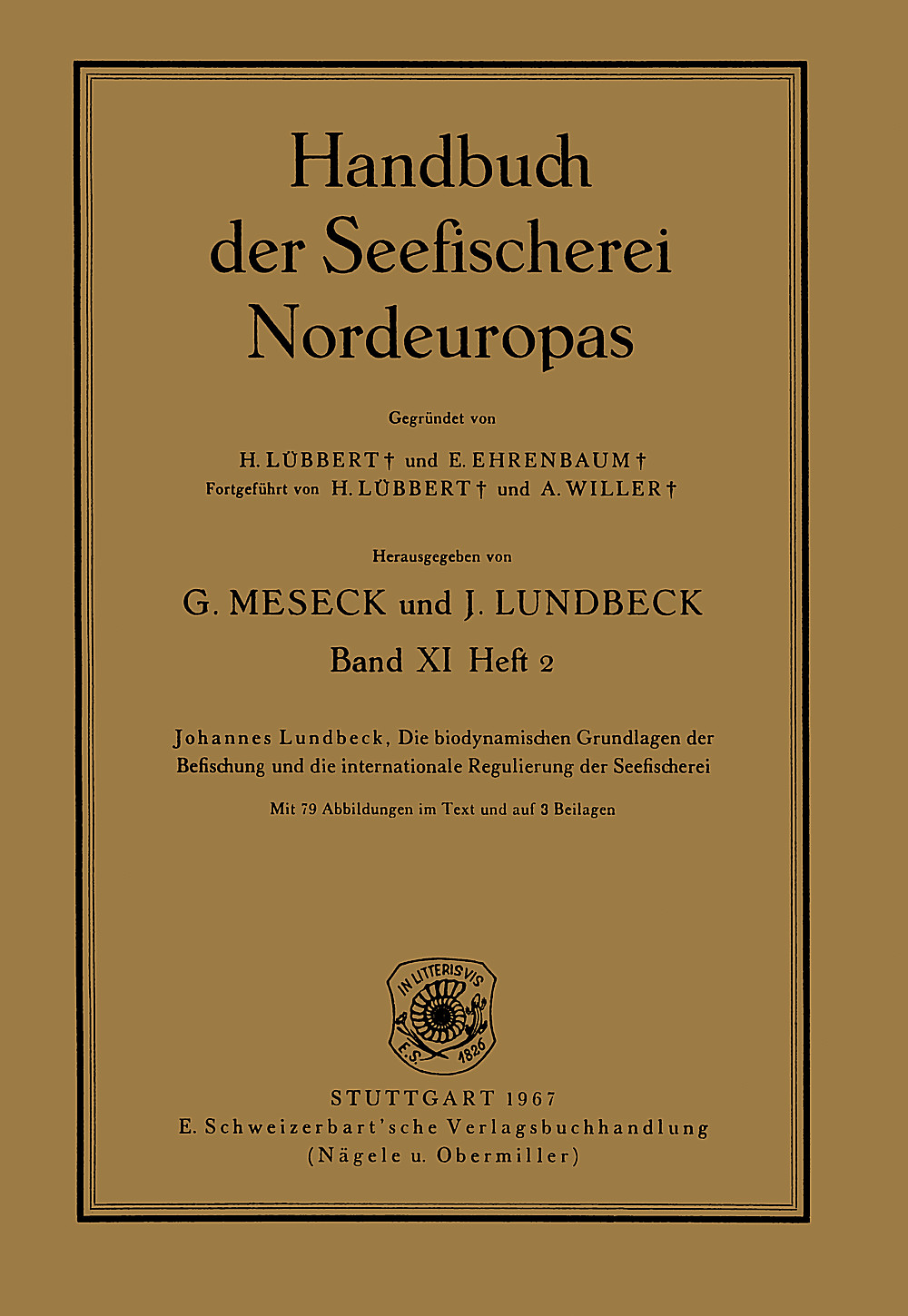Inhaltsbeschreibung nach oben ↑
Wie wirkt sich die Befischung auf die natürlichen Fischbestände aus? Seitdem es eine moderne Seefischerei gibt, steht diese Frage im Vordergrund aller Diskussionen über die Fischerei, viele Kontroversen entstanden darüber. Internationale Organisationen sind ins Leben gerufen worden, nur um dieses Thema zu behandeln. Dennoch werden die widersprechendsten Auffassungen dazu vertreten. Im Rahmen des "Handbuches der Seefischerei" erschien daher eine ausführliche Übersicht zu diesem Zentralthema notwendig.
Die ersten Kapitel verfolgen die im Laufe von rund 100 Jahren gewonnenen Erfahrungen, die sich aus der Intensivierung der Befischung und im Gegensatz dazu aus der Schonung der Fischbestände, bedingt durch die letzten Kriege, ergaben. Die Fangstatistik wurde laufend verbessert, und allmählich wurden wissenschaftlich gesicherte Ergebnisse gewonnen.
Erst neuerdings fußen diese Deutungen auf der Grundlage der Biodynamik, die ausschließlich die ständig, d. h. praktisch seit Jahrzehnten erzielten, relativ hohen Fischausbeuten zu erklären vermag. Der Verfasser erklärt eingehend die Lebensgewohnheiten der Fische und alle Faktoren, die sie beeinflussen. Es wird besprochen, wie das Wachstum einer Fischpopulation vor sich geht, wie die Sterblichkeit den Bestand verkleinert und die individuelle Lebensdauer bestimmt, wie ferner die Fortpflanzung geregelt wird und wie sich die Brutentwicklung für die Bestandserhaltung auswirkt. Der Autor erläutert außerdem, wie regellose, gleichgerichtete und oszillierende, oder klimatisch bedingte Einwirkungen Schwankungen im Fischbestand hervorrufen. Bewußt wird dabei die mathematische Behandlung auf ein Minimum beschränkt, denn Gleichungen und Kurven sind zwar als Arbeitsmethode unentbehrlich, aber beweisen keine Gesetzmäßigkeiten.
Die Grundlage der biodynamischen Betrachtung beruht darin, die biologischen Vorgänge aufzuzeigen und diese in allen Einzelheiten zu verfolgen. Bei der Schilderung der Fangerträge wird besonders zwischen dem Einzelfang eines Fischereifahrzeuges unterschieden, der von der jeweiligen Bestandsstärke oder Dichte an Fischen abhängt und dem Gesamtfang in einem bestimmten Gebiet, dem die Bestandsproduktivität zugrunde liegt. Diese muß dem Gleichgewichtsbestand etwa entsprechen, der theoretisch einzig und allein zu betrachten ist. Früher rief gerade die unscharfe Trennung eines Einzelfanges vom Gesamtfang viel Verwirrung hervor. Zwar stehen beide miteinander in enger Beziehung, aber sie verändern sich ungleich. Noch ist heute nicht jedermann klar geworden, daß ein höherer Gesamtfang auf Kosten eines sinkenden Einzelfanges gehen muß, d. h., sinkt der Einzelfang, so ist dies ein unvermeidliches Übel und nicht von vornherein ein Zeichen für Überfischung.
Aus diesen grundsätzlichen Darlegungen des Verfassers lassen sich letztlich die möglichen Maßnahmen ableiten, die für die Regulierung der Seefischerei in Frage kommen. Zum Schluß des Werkes wird eine Übersicht der (bisher wenigen) internationalen Vereinbarungen gegeben, die für bestimmte Meeresgebiete getroffen wurden oder sich auf bestimmte Fischarten beziehen. Die vielerlei Unterlagen zu diesem Werk wurden vom Verfasser in jahrelanger, mühsamer Arbeit zusammengetragen. Für jeden Fischereiwissenschaftler ist das Buch unentbehrlich. Jeden Biologen interessiert es besonders deshalb, weil hier die Einwirkungen des Menschen auf eine natürliche Population, nämlich den Fischbestand, beschrieben werden, die sich mit Änderungen der natürlichen Umweltfaktoren verzahnen.