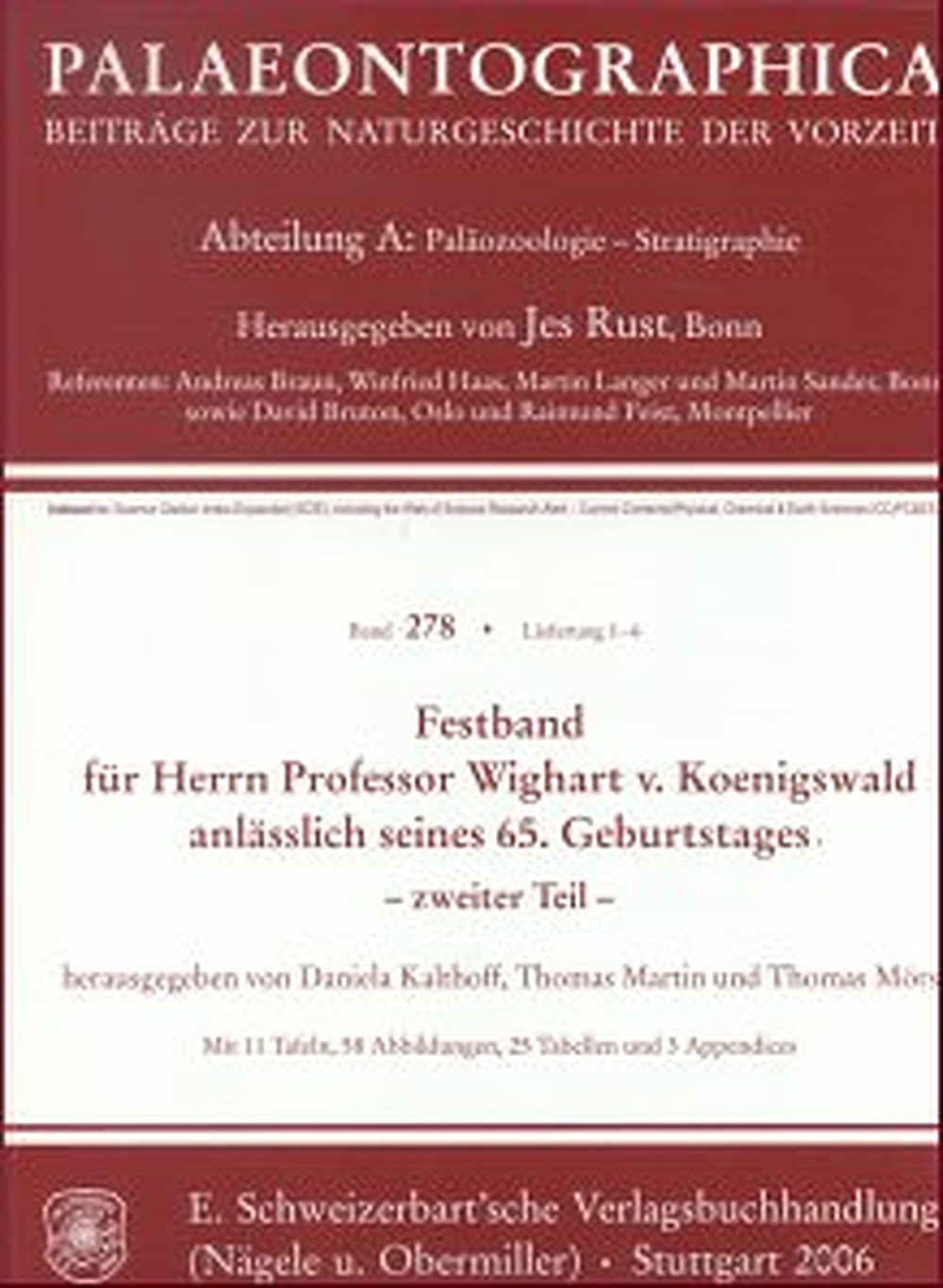WIGHART VON KOENIGSWALD, Professor für Paläontologie an der
Universität Bonn, ein engagierter Hochschullehrer und auf vielen
Gebieten der Säugetierpaläontologie kundiger wie aktiver und
renommierter Forscher, beging im September 2006 seinen 65. Geburtstag,
ein Datum, das gewöhnlich die Versetzung in den Ruhestand
bedeutet. Für VON KOENIGSWALD dürfte Ruhestand wohl nur Befreiung von
administrativen Pflichten und Zeit für weitere wissenschaftliche
Aktivitäten bedeuten. Es ist aber auch ein Datum, um Bilanz zu ziehen,
und die kann sich bei WIGHART VON KOENIGSWALD durchaus sehen lassen,
wie die Vita und Widmung von dreien seiner Schüler, DANIELA KALTHOFF,
THOMAS MARTIN und THOMAS MÖRS eindrucksvoll zeigen. Sie sind auch die
Herausgeber der zweibändigen Festschrift mit insgesamt 26 Beiträgen
von 41 Autoren, die anlässlich des 65. Geburtstags von WIGHART VON
KOENIGSWALD verfasst wurde. Die Autoren sind Schüler, darunter auch
sein Nachfolger als Institutsvorstand in Bonn, THOMAS MARTIN, und
wissenschaftliche Wegbegleiter aus dem In- und Ausland. Die Beiträge
decken jene Gebiete der Säugetierpaläontologie ab, in denen WIGHART
VON KOENIGSWALD selbst aktiv, zum teil prägend war.
Der erste Teil enthält neben der Widmung der Herausgeber dreizehn
Beiträge: M. C.MCKENNA & J. A. LILLEGRAVEN: Biostratigraphic deception
by the Devil, salting fossil kollinbrains into the Poobahcene section
of central Myroaming.- Dieser Beitrag ist amüsant zu lesen, aber nicht
ganz Ernst zu nehmen. In einer Satire warnen die Autoren vor einer
voreiligen Biozonierung und Einführungen von Evolutionshypothesen auf
der Basis zu dürftiger Daten.
W. A. CLEMENS: Early Paleocene (Puercan) peradectid marsupials from
northeastern Montana, North American Western Interior.- Der Autor
weist anhand von Molaren aus zwei Fundstellen im nordöstlichen Montana
das Vorkommen von zwei Arten peradectider Beuteltiere nach. Die
Gattung Thylacodon betrachtet er vorläufig als nomen dubium und
beschreibt die Art Peradectes minor n. sp. neu. Das Western Interior
Basin ist das einzige Gebiet, in dem aus dem Übergang von der Kreide
zum Tertiär Beuteltiere detailliert überliefert sind, wenngleich bei
deutlich abnehmender taxonomischer Diversität.
M. R. DAWSON: A new early Eocene Microparamys (Mammalia, Rodentia)
from the Wind River Basin, Wyoming.- Die Autorin beschreibt anhand
eines 148 Paläontologie allgem. Unterkiefers mit p4-m3 von einer
untereozänen Fundstelle in Natrona County in Wyoming die neue Art
Microparamys regisylvestris n. sp. aus der Nagerfamilie
Ischyromyidae. Sie ist durch eine primitive Kauflächenmorphologie mit
einem abgeleiteten Höckerchen gekennzeichnet.
J. H. WAHLERT, W. W KORTH & M. C. MCKENNA: The skull of Rapamys
(Ischyromyidae, Rodentia) and description of a new species from the
Duchesnean (late Middle Eocene) of Montana.- Die Autoren beschreiben
die neue Ischyromyidenart Rapamys atramontis n. sp. Nach Resten von
drei Individuen wird die Bezahnung mit der Schmelzstruktur des
Incisivus beschrieben und der Schädel rekonstruiert. Der Vergleich mit
anderen ischyromyiden Nagern zeigt, dass Rapamys der Gattung
Reithroparamys sehr nahe steht und in die Unterfamilie
Reithroparamyinae der Ischyromyidae zu stellen ist.
T.MARTIN: Incisor enamel microstructure of Ischyromyoidea and the
primitive rodent schmelzmuster.- Der Autor beschreibt das
Schmelzmuster der Incisiven bei den Ischyromyoidea und kennzeichnet es
als pauciserial. Das abgeleitete uniseriale Schmelzmuster entwickelte
sich in verschiedenen Zweigen der Nagetiere unabhängig aus dem
pauciserialen.
D. C. KALTHOFF: Incisor enamel microstructure and its implications to
higher level systematics of Eurasian Oligocene and Early Miocene
hamsters (Rodentia). Die Autorin untersuchte die
Schmelzmikrostrukturen an den unteren Schneidezähnen aus dem Oligozän
und dem unteren Miozän Eurasiens. Sie diskutiert die taxonomische
Relevanz für die Hamsterklassifikation und die systematische Zuordnung
einiger nordamerikanischer Hamstergattungen.
M. G. VUCETICH & E. M. VIEYTES: A Middle Miocene primitive octodontoid
rodent and its bearing on the early evolutionary history of the
Octodontoidea.- Die Autorinnen beschreiben das neue octodontoide
Nagertaxon Plesiacarechimys koenigswaldi n. gen. et n. sp. aus dem
Mittel-Miozän von Nordwest-Patagonien anhand der Morphologie der
Molaren und und der Schmelzstruktur der Incisiven.
K. HEISSIG: Biostratigraphy of the "main bentonite horizon¡ of the
Upper Freshwater Molasse in Bavaria." Der Autor korreliert den östlich
von Augsburg gefundenen Hauptbentonit in der Oberen Süßwassermolasse
anhand von Säugerfaunen der "Zone" MN 6 der europäischen
Säuger-"Zonierung" des Neogens. Aus den nur geringen Unterschieden
der Nagerfaunen oberhalb und unterhalb des Bentonits schließt er auf
dessen kurze Ablagerungszeit.
G. E. RÖSSNER: A community of Middle Miocene Ruminantia (Mammalia,
Artiodactyla) from the German Molasse Basin.- Die Autorin beschreibt
eine kleine Wiederkäuerfauna aus dem mittleren Miozän des süddeutschen
Molassenbeckens anhand von Gebissresten, darunter ein nahezu
vollständiger Unterkiefer, und eines relativ vollständigen Geweihs von
Stehlinoceros elegantulus. Die Funde ergänzen unsere Kenntnis über die
Abfolge von Wiederkäuergemeinschaften im Molassebecken und stehen im
Einklang mit jüngst postulierten Vorstellungen zu einer zunehmenden
Saisonalität im mittleren Miozän Mitteleuropas.
J. DALSÄTT, T. MÖRS & P. G. P. ERICSON: Fossil birds from the Miocene
and Pliocene of Hambach (NW Germany).- Die Autoren stellen die
Vogelreste der mittelmiozänen (MN 5) und oberpliozänen (MN 16)
Fundstellen Hambach 6C Lehrbücher, zusammenf. Darstellungen,
Bibliographien 149 und Hambach 11/13 in der Niederrheinischen Bucht
vor. Unter den in der Anzahl dürftigen Resten ist der früheste
Nachweis des Schlangenhalsvogels Anhinga pannonica LAMBRECHT, 1916 in
Hambach 6C. Dieses tropische Element in der Hambacher Fauna ist ein
weiterer Hinweis auf das mittelmiozäne Klimaoptimum.
L. WERDELIN & R. SARDELLA: The "Homotherium¡" from the Langebaanweg,
South Africa and the Origin of Homotherium.- Ein oberer Caninus und
einige postcraniale Knochen von einer Fundstelle in der Kapprovinz in
Südafrika, die bisher als Homotherium identifiziert wurden, zeigen
keine apomorphen Merkmale von Homotherium und werden daher zu
Amphimachairodus sp. gestellt. Die Autoren sehen einen deutlichen
morphologischen Hiatus zwischen Homotherium und seinen Vorläufern.
M. FORTELIUS & Z. ZHANG: An oasis in the Desert? History of endemism
and climate in the Late Neogene of North China.- Die Autoren stellen
im obersten Miozän in Nordchina eine Zunahme der Humidität fest, die
dem globalen Trend einer Aridisierung des Klimas in mittleren Breiten
im späten Neogen entgegen steht. Die zunehmende Humidität beeinflusste
die Evolution der herbivoren Landsäuger der Region erheblich und
förderte eine verstärkte Einwanderung und später die Entwicklung
endemischer Taxa. Der Einfluss dieser Baodean-Anomalie verschwindet
abrupt und Nordchina wird Teil der paläarktischen Faunenprovinz. Die
Autoren erklären die Entwicklung der nordchinesischen Landsäugerfaunen
des obersten Miozäns durch das KOENIGWALDsche Modell, wonach sich zwei
getrennte Faunenassoziationen zyklisch ablösen und in einer
Übergangszone vermischen.
P. M. SANDER&P. ANDRÁSSY: Lines of arrested growth and long bone
histology in Pleistocene large mammals from Germany: What do they tell
us about dinosaur physiology? - Die Autoren untersuchen die
Wachstumsstillstandslinien in Knochen, die typische Merkmale in der
Knochenhistolgie ektothermer Tetrapoden sind, bei herbivoren
Großsäugern aus dem Jung-Pleistozän Deutschlands. Die meisten Proben
weisen eine oder mehrere Wachstumsstillstandslinien mit regelmäßigen
Abständen auf. Es gibt auch überraschenderweise deutliche Unterschiede
in der Histologie der einzelnen Taxa. Das häufige Auftreten von
Wachstumsstillstandslinien in den Knochen der endothermen pleistozänen
Säugetiere weckt bei den Autoren Zweifel an der Deutung der
Stillstandslinien im Dinosaurierknochen als Zeichen für eine
ektotherme Physiologie.
Der zweite Teil umfasst ebenfalls dreizehn Beiträge:
M. DORKA & W.-D. HEINRICH: Tetrapod teeth from a Rhaetian (Upper
Trias) bonebed near Friedland (NW-Germany).- Die Autoren stellen
Tetrapodenzähne aus einem raetischen Bonebed von Friedland bei
Göttingen in Form von detaillierten Beschreibungen und von
informativen rasterelektronenmiskroskopischen Aufnahmen vor. Sie
stammen von nicht näher bestimmbaren Archosauriformen, Cynodontiern,
einem Synapsiden und von Haramyiden. Eine derartigen
Vergesellschaftung von Tetrapodenzähnen war aus dem zentralen Bereich
des Germanischen Beckens bislang nicht bekannt.
A. SAHNI: Biotic Response to the India-Asia Collision: changing
palaeoenvironments and vertebrate faunal relationships. - Die
biotische Reaktion auf die Norddrift der indischen Landmasse von der
mittleren Ober-Kreide bis zum Ende des Unter-Eozän lässt sich in drei
Phasen einteilen: Rift-, Drift- und Kollisionsphase. Die Verf. zeigen
in diesem Überblick Ähnlichkeiten und Unterschiede zu den Biota der
benachbarten Kontinente während der verschiedenen Phasen.
J. L. FRANZEN: A pregnant mare with preserved placenta from the Middle
Eocene maar of Eckfeld, Germany. - Der Autor beschreibt eine trächtige
Urpferdstute von Propalaeotherium voigti aus dem Mittel-Eozän (oberes
Geiseltalium, MP 13) des Eckfelder Maars (Rheinland-Pfalz). Teile des
Fötus sind von Plazentarelikten bedeckt. Aus dem Vorhandensein von nur
einem Fötus schließt der Autor auf k-Strategie in der Fortpflanzung
(Aufzucht von nur wenig Nachkommen mit intensiver Brutpflege) und auf
eine gesellige Lebensweise, was ihre relative Häufigkeit in
Fundstellen wie Messel, Eckfeld und dem Geiseltal erklärt.
K. D. ROSE: The postcranial skeleton of early Oligocene Leptictis
(Mammalia: Leptictida), with preliminary comparison to Leptictidium
from the middle Eocene of Messel. - Der Autor beschreibt ein nahezu
vollständiges Skelett des Leptictiden Leptictis dakotensis aus
Sedimenten der unteroligozänen White River-Formation von Wyoming und
vergleicht es mit dem Pseudorhynchocyoniden Leptictidium
nasutum. Leptictis zeigt eine Reihe von Merkmalen (z.B. Verschmelzung
von Tibia und Fibula, relativ lange Hinterextremitäten und kurze
Vorderextremitäten), die auf eine cursoriale und gelegentliche
saltatorische Fortbewegung hinweisen. Merkmale an Humerus und Scapula
zeigen, das Leptictis seine Fähigkeit zu graben beibehielt. Die
Ähnlichkeiten von Leptictidium und Leptictis im Skelett bezeugen die
enge Verwandtschaft zwischen Pseudorhynchocyoniden und
Leptictiden. Leptictidium hat aber stärker reduzierte Vordergliedmaßen
und nicht verschmolzene Tibia und Fibula.
F. J. GOIN: A review of the Caroloameghiniidae, Palaeogene South
American "primate-like" marsupials (?Didelphimorphia,
Peradectoidea). - Die Autorin gibt einen Überblick über die
Caroloameghiniiden, kleine, vermutlich frugivore Beuteltiere aus dem
Paläogen von Südamerika. Sie listet alle bekannten Arten auf,
inklusive Angabe des Holotypus, der Maße sowie, der geographischen und
stratigraphischen Verbreitung. Ihre Anpassung an die frugivore
Ernährungsweise korreliert mit der Ausdehnung subtropisch-tropischer
Regenwälder in Südamerika währende der "greenhouse"-Phase des
Känozoikums. Das Verschwinden der Caroloameghiniiden im frühesten
Oligozän fällt mit der an der Wende Eozän/ Oligozän einsetzenden
Abkühlungsphase zusammen.
C. KURZ: Preservation and frequency of occurrence of cranial and
skeletal remains of European Tertiary marsupials. - Anhand des reichen
Materials der untermiozänen Fundstelle Petersbuch 2 bei Eichstätt
zeigt die Autorin, dass insbesondere postcraniale Elemente von
Beuteltieren selten überliefert sind. Sie führt dies auf den bei
Beuteltieren verzögerten Epiphysenschluss und damit die geringere
Erhaltungschance der postcranialen Knochen zurück.
B. REICHENBACHER & J. PRIETO: Lacustrine fish faunas (Teleostei) from
the Karpatian of the northern Alpine Molasse Basin, with a description
of two new Lehrbücher, zusammenf. Darstellungen, Bibliographien 151
species of Prolebias SAUVAGE. - Autorin und Autor dokumentieren die
Süßwasserfischfauna aus der Oberen Süßwassermolasse der Tongrube
Attenfeld bei Neuburg an der Donau anhand von Otolithen. Sie
beschreiben die neuen cyprinodontiformen Arten Prolebias wigharti
n. sp. und Prolebias kirstinae n. sp. Biostratigraphisch gehört die
Fauna in das Karpatium und in die Säuger-Einheit MN 5. Die trophische
Struktur der mit zehn Arten relativ diversen Fischfauna weist auf
einen ausgedehnten See mit oligo- bis mesotrophen Bedingungen hin, die
Anreicherung der Otolithen auf großen Individuenreichtum der
ehemaligen Fischfauna. Aus den fossilen Fischfaunen schließen die
Autoren, dass während des Karpatium im Molassebecken große permanente
Seen entstanden, die Lebensräume für neue endemische Arten boten. Die
möglichen Ursachen werden diskutiert.
O. FEJFAR, G. STORCH & H. TOBIEN†: Gundersheim 4, a third Ruscinian
micromammalian assemblage from Germany. - Die Autoren beschreiben
anhand von Material aus der Spaltenfüllung Gundersheim 4 (Landkreis
Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz) eine neue Kleinsäugerfauna. Sie
diskutieren Morphologie und Beziehungen der wichtigen Arten der
Hasenartigen, Nager und Insektenfresser. Für die Gattung
Paenelimnoecus führen sie die neue soricide Unterfamilie
Paenelimnoecinae nov. subfam. ein, um ihrer Sonderstellung innerhalb
der Soriciden Rechnung zu tragen.
M. ERBAJEVA, A. NADEZHDA & F. KHENZYKHENOVA: Review of the Pliocene-
Pleistocene arvicolids of the Baikalian region. - Die Autoren
präsentieren in Faunenlisten die plio-pleistozänen Arvicoliden der
Baikalregion des südlichen Ostsibirien, insgesamt 20 Gattungen mit
über 50 Arten. Im frühen Pliozän sind sie noch selten; danach nehmen
Häufigkeit und Diversität bis zum Pleistozän stetig zu. Die
Verf. weisen die Gattung Pitymimomys erstmals in Transbaikalien nach
und beschreiben die neue mittelpleistozäne Art Pitymimomys
koenigswaldi n. sp. Zahnmorphologisch und in ihrer
Schmelzstruktur. Sie fassen die Arvicolinen im systematischen Teil und
in Tab. 1, wie heute üblich, als Subfamilie Arvicolinae der Familie
Cricetidae auf. In der Zuordnung des Taxons sind sie aber
inkonsequent, indem sie im Titel arvicolids anstatt arvicolins
schreiben. In Summary und Zusammenfassung weisen sie die Arvicolinen
als Subfamilie Microtinae den Arvicoliden, also der Familie
Arvicolidae zu, so wie dies früher üblich war.
K. AARIS-SØRENSEN: Northward expansion of the Central European
megafauna during late Middle Weichselian interstadials, c. 45 - 20 ky
BP. - Der Autor dokumentiert anhand von 180 Knochen, Zähnen und
Geweihfragmenten aus glazialen oder fluvioglazialen weichselzeitlichen
Ablagerungen Südskandinaviens sechs verschieden große herbivore
Säugetiere. Am häufigsten sind Mammuthus primigenius, gefolgt von
Rangifer tarandus, Bison priscus, Megaloceros giganteus, Ovibos
moschatus und Equus ferus. Sie dokumentieren die Ausweitung der
europäischen Mammutsteppe in das südliche Skandinavien während des
späten Mittelweichsel.
H.-U. PFRETZSCHNER: Collagen gelatinization: the key to understand
early bone-diagenesis. - Der Autor ermittelt mit Hilfe experimenteller
Untersuchungen die Proteinabbauraten in Knochen während der
Zersetzung. Die während der Frühdiagenese mikrobiell abgebaute
Proteinmenge fällt mit 5-10% des Gesamt152 Paläontologie allgem.
kollagengehalts des frischen Knochens bei Langknochen überraschend
gering aus. Der Autor schließt daraus, dass die Hauptmenge des
Kollagens durch chemische Abbaureaktionen und Auslaugung aus dem
Knochen entfernt wird, und er beschreibt die damit verbundenen
Vorgänge detailliert.
J. M. RENSBERGER & C. STEFEN: Functional differentiation of the
microstructure in the upper carnassial enamel of the spotted hyena. -
Die Autoren dokumentieren die Mikrostruktur des Schmelzes im oberen
vierten Prämolaren, dem Reißzahn, von Crocuta crocuta und
unterscheiden drei Bereiche, die sie verschiedenen Funktionen
zuweisen. Aus der Konfiguration des Schmelzmusters schließen sie, dass
das Knochenbrechen auf die vordere Hälfte des Paracons beschränkt ist
und dass dazu eine genaue Positionierung des zu brechenden Knochens
nötig ist.
N. SCHMIDT-KITTLER: Microdonty and macrodonty in herbivorous mammals. -
Der Autor geht von der Beobachtung aus, dass es bei herbivoren
Säugetieren lange (makrodonte) und kurze (mikrodonte) Backenzahnreihen
gibt, die oft mit stark oder wenig gefalteten Okklusionsmustern der
Zähne korrelieren. Er entwickelt eine Methode zur Quantifizierung von
Makrodontie und Mikrodontie und des Vergleichs mit funktionell
relevanten Parametern der Bezahnungen und wendet sie auf hochkronige
muroide und caviomorphe Nagetiere sowie auf Pflanzenfresser an. Er
diskutiert auch die Beziehungen zwischen Mikrodontie bzw. Makrodontie
und Nahrungspräferenzen.
Die Beschreibungen in den deskriptiven Teilen der Beiträge sind
ausführlich, die wichtigen Objekte in informativen Zeichnungen und
Photographien sowie die Schmelzmuster in
rasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen hervorragend abgebildet. Die
Schlussfolgerungen sind durch die Befunde belegt. Nicht jeder Artikel
ist für jeden Säugetierpaläontologen relevant, aber für Jeden ist
darin etwas Wichtiges zu finden. Das Werk braucht man nicht zu
empfehlen. Die Palaeontographica gehört ohnehin in jede
paläontologische Bibliothek. Autoren und Herausgebern ist ein
umfängliches und qualitativ hervorragendes Werk zum Geburtstag von
WIGHART VON KOENIGSWALD gelungen, ein Opus, das der Jubilar verdient
hat.
R. ZIEGLER
Zentralblatt für Geol. u. Pal. Teil II, Jg. 2007, H. 1-2