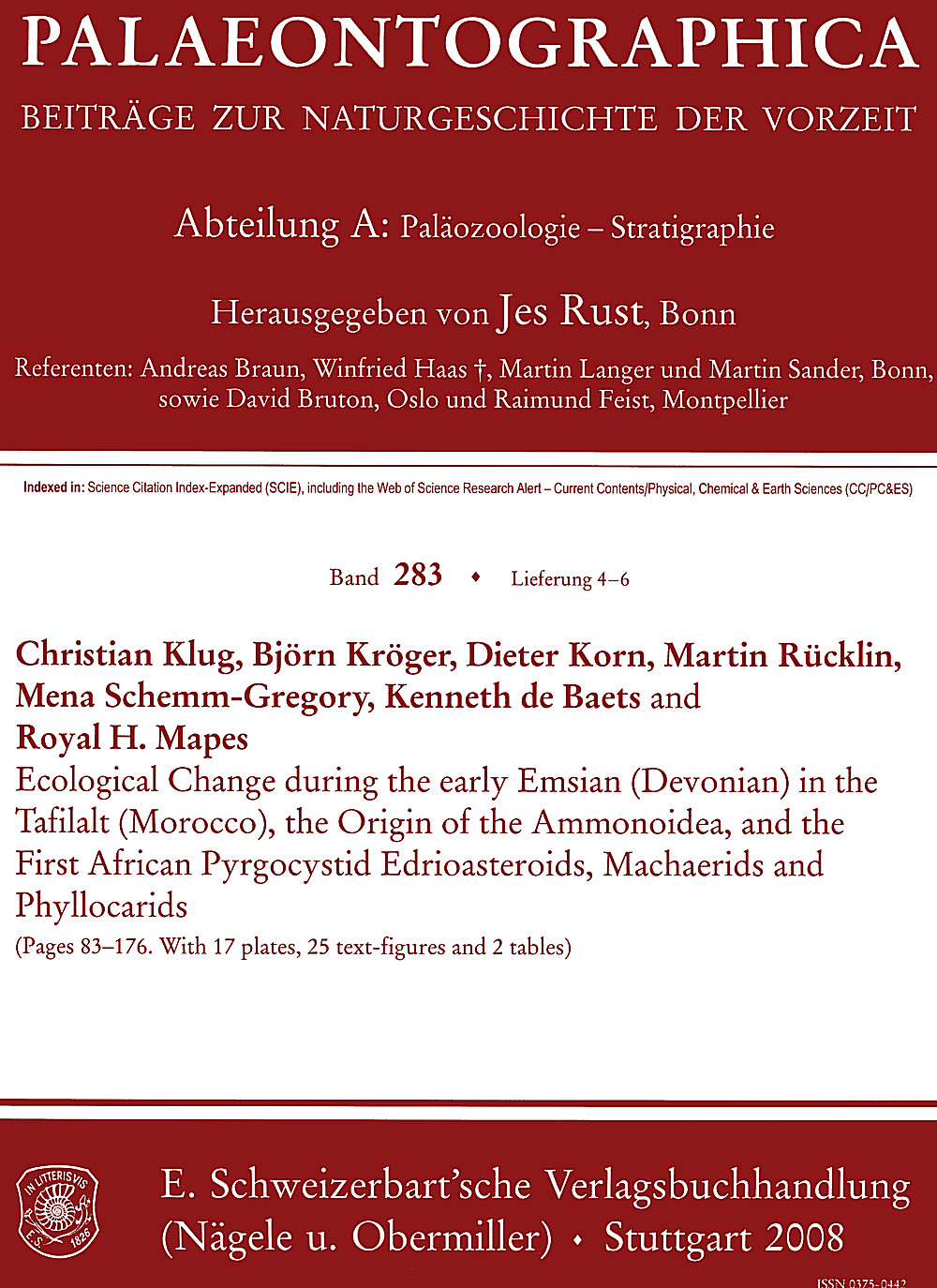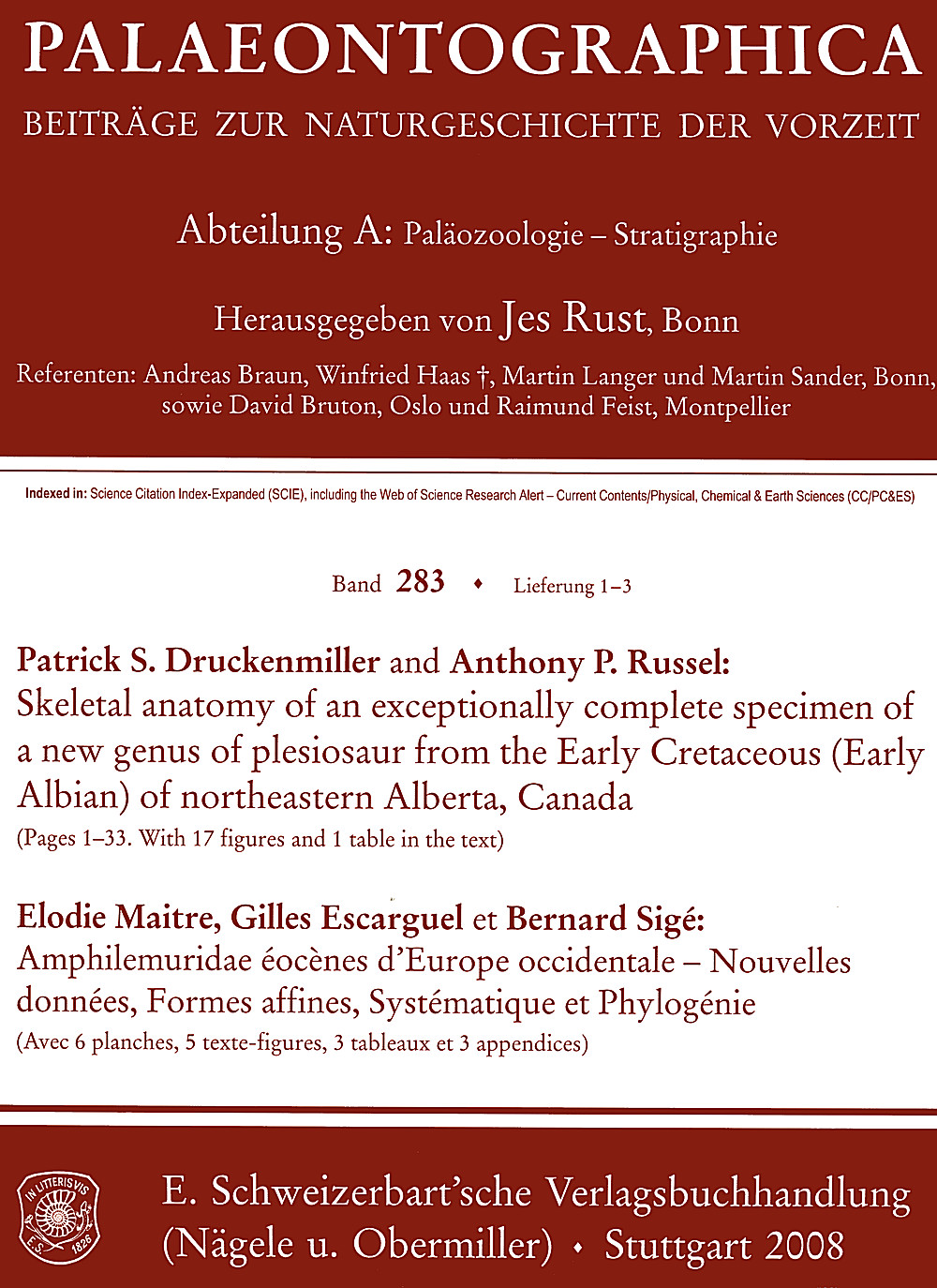In Ton- und Mergelsteinen des Unter-Emsium der Profile Bou Tchrafine,
Achguig, Hassi Chebbi, Ouidane Chebbi, Oued Chebbi und am Jebel
Ouaoufilal im nordöstlichen Tafilalt Marokkos enthielten zwei
reichhaltige, aber unterschiedlich alte Faunen in der oberen Seheb El
Rhassel-Gruppe mindestens 100 Invertebratenund Vertebratenarten mit
zusammen rund 5.000 Individuen. In der älteren Fauna (Dehiscens-Zone,
unteres Zlichovium) sind zahlreiche Reste der möglicherweise ältesten
Bactriten, artikulierte pyrgocystide Edrioasteroidea (Echinodermata),
Carapaxe von Phyllocariden, artikulierte asteropygide Trilobiten und
seltener paarig überlieferte Flossenstacheln von Acanthodiern und
artikulierte Machaeridier enthalten, zusammen mit einer mittel- bis
hoch-diversen Bivalvenfauna, die im Sediment lebte. In der jüngeren
Fauna (oberes Zlichovium) finden sich die ersten Ammonoideen mit den
Gattungen Chebbites, Erbenoceras, Gracilites, Gyroceratites,
Irdanites, Lenzites und Metabactrites, begleitet von zahlreichen
Bactriten, anderen Cephalopoden, Gastropoden und überwiegend
epibyssaten Muscheln. Während des unteren Emsium herrschten im Gebiet
des Tafilalt nahezu normale oxische Verhältnisse bei mäßiger
Wassertiefe unterhalb der Sturmwellenbasis und innerhalb der tieferen
photischen Zone. Dies ergibt sich aus dem Vergleich der beiden Faunen,
ihrer Erhaltung und der Lithologie der Matrix. Das Sediment und das in
ihm lebende Benthos mit seiner hohen Diversität sind typisch für
Weichböden. Die Verf. werteten Änderungen in der Artzusammensetzung
während des unteren Emsium aus, die vermutlich auf eine Abnahme des
Sauerstoffgehaltes in den tieferen Wasserschichten und damit auch im
Sediment zurückgehen. Möglicherweise führte die Sauerstoffarmut im
Emsium zu einem erhöhten ökologischen Druck und damit zu einer
rascheren Radiation der Ammonoideen. Weltweit dürften sich ein Anstieg
des Meeresspiegels [der ja für die Abnahme des Sauerstoffgehalts am
Meeresboden verantwortlich sein kann] und zudem die Evolution der
Gnathostomata ausgewirkt haben.
Beschrieben und abgebildet sind eine unbestimmte rugose Koralle, die
Monoplacophoren Crenistriella sp., Sinuitina (Sinuitina) sp., die
Gastropoden Palaeozygopleura sp., Murchisonia (Murchisonia) sp.,
Lukesispira pulchra FRÝDA & MANDA, 1997, Pleurotomariinae n. gen. et
n. sp., Rotellomphalus tardus (PERNER, 1903), Oristostoma sp.,
Platyceras (Platystoma) sp., Pl. (Orthonychia) sp., die Muscheln
Nuculoidea grandaeva (GOLDFUSS, 1840), Eonuculoma babini n. gen.
Paläozoische Faunen 1103 et n. sp., Palaeoneilo emarginata (CONRAD,
1841), Nuculites (Gonionuculites) celticus BABIN et al., 2001,
Cucullaea (Cucullaea) triquetra (CONRAD, 1841), Phestia rostellata
(CONRAD, 1841), Panenka cf. hollandi KŘÍŽ, 2000, Patrocardia evolvens
evolvens (BARRANDE, 1881), P. excellens (BARRANDE, 1881), P. cf. tarda
(BARRANDE, 1881), P. sp., Spanila discipulus BARRANDE, 1881, Mytilarca
cf. chemungensis (CONRAD, 1842), Grammysioidea sp., die Nautiloidea
Archiacoceras sp., Arthrophyllum vermiculare (TERMIER & TERMIER,
1950), Murchisoniceras murchisoni (BARRANDE, 1865), die Orthoceraten
Chebbiceras erfoudense n. gen. et n. sp., Infundibuloceras brevimira
n. gen. et n. sp., Neocycloceras sp., Orthocycloceras n. sp. A,
O. sp. B, Plagiostomoceras hassichebbiense n. sp., Parakionoceras sp.,
Temperoceras sp., Pseudoorthoceratidae gen. et sp. indet., die
Nautiliden Trochoceras sp., die Bactritoiden Devonobactrites
obliqueseptatus (SANDBERGER & SANDBERGER, 1852), Cyrtobactrites
scheffoldi n. sp., die Ammoniten Metabactrites ernsti n. sp.,
Mimosphinctinae gen. et sp. indet., der Hyolithe „Orthotheca“ sp., der
Cryoconaride Nowakia zlichowensis magrebiana ALBERTI, 1982, der
Machaeridier Lepidocholeus rugatus n. sp., die Trilobiten Cornuproteus
(Sculptoproetus) maghrebus ALBERTI, 1967, Phacops (Phacops) saberensis
cf. torkozensis SCHRAUT, 2000, Ph. (Reedops) cf. cephalotes cephalotes
HAWLE & CORDA, 1847, Metacanthina wallacei (TERMIER & TERMIER, 1950),
?M. sp., Pilletina zguidensis MORZADEC, 2001, Leonaspis (Leonaspis)
issoumourensis ALBERTI, 1970, die Phyllocariden Ceratiocaris sp.,
Nahecaris jannae n. sp., N. malvinae n. sp., die Brachiopoden
Rugoleptaena cf. hornyi (HAVLÍČEC, 1967), ?Leptodontella cf. caudata
(SCHNUR, 1854), cf. Linguopugnoides sp., cf. „Camarotoechia“
marocanensis DROT, 1964, Ardusprifer arduennensis n. ssp.,
Quadrithyris termierae DROT, 1964, cf. Protathyris sp., cf. Svetlania
sp., cf. Merista sp., Globithyris sp. sowie die Edrioasteriden
Rhenopyrgus flos n. sp., Pyrgocystis cf. octogona RICHTER, 1930,
Crinoidea gen. et sp. indet., der brachythoracide Placoderme gen. et
sp. indet., der Acanthodier Machaeracanthus cf. peracutus NEWBERRY,
1857, M. sp. und das Spurenfossil Nododendrina sp. Somit sind
erstmalig Vertreter der Familien Pyrgocystidae, Lepidocoleidae und
Carapaxe von Phyllocariden in Afrika nachgewiesen.
Die Tafeln mit vorzüglichen Schwarzweiß-Fotos sind sehr sorgfältig
zusammengestellt und erfreulicherweise bestens reproduziert. Es wäre
interessant, unter der hier beschriebenen Nautiliden- und
Bactritenfauna einmal nach echten und frühen Coleoidea zu
suchen. Zudem sollte man die Mikrofaunen auswerten, um die hier
gezogenen paläökologischen Schlüsse (z. B. die Bathymetrie und den
Sauerstoffgehalt betreffend) weiter zu untermauern.
W. RIEGRAF
Zentralblatt Geol. Pal. T. II Jg. 2008 H. 5/6