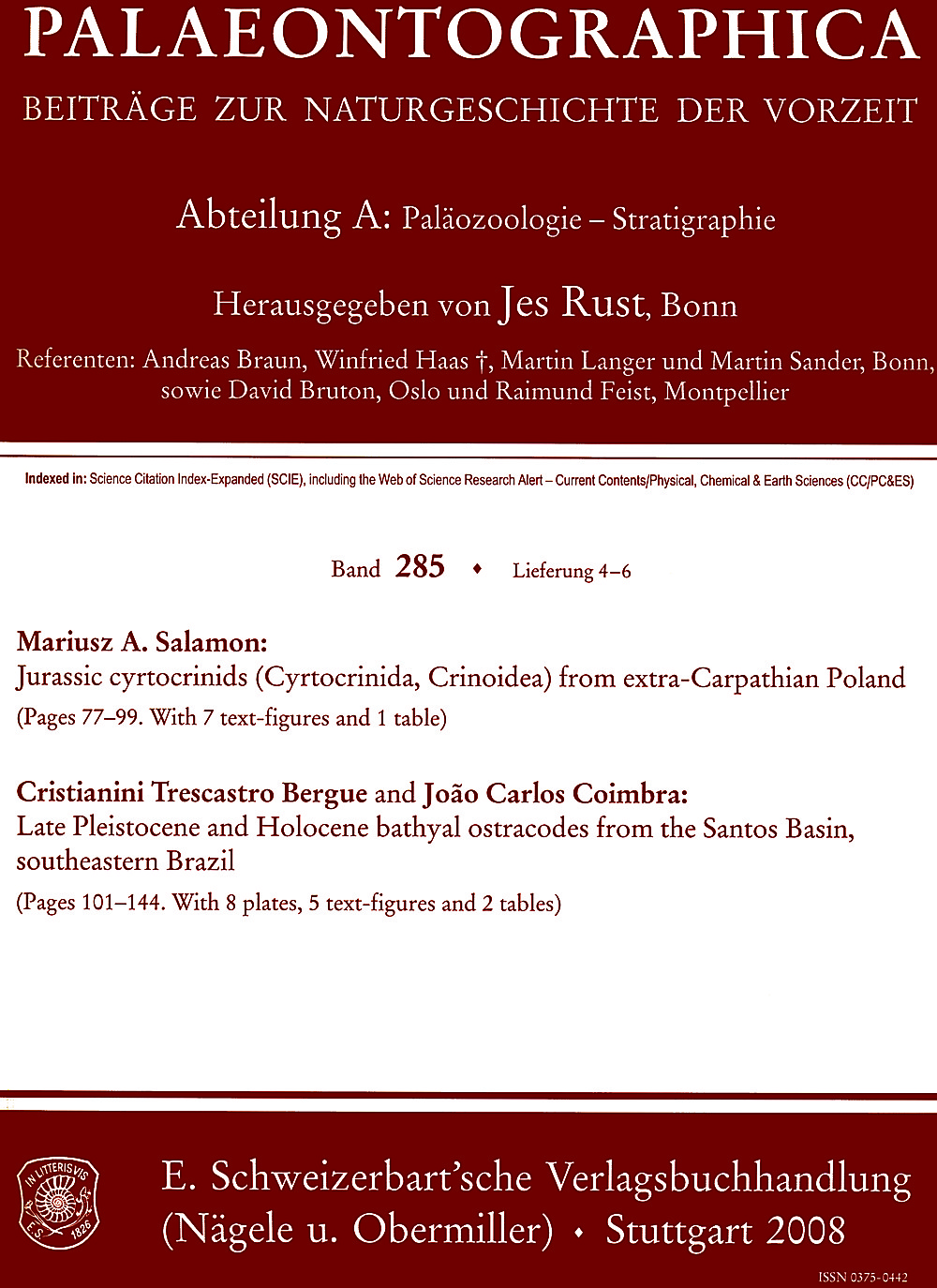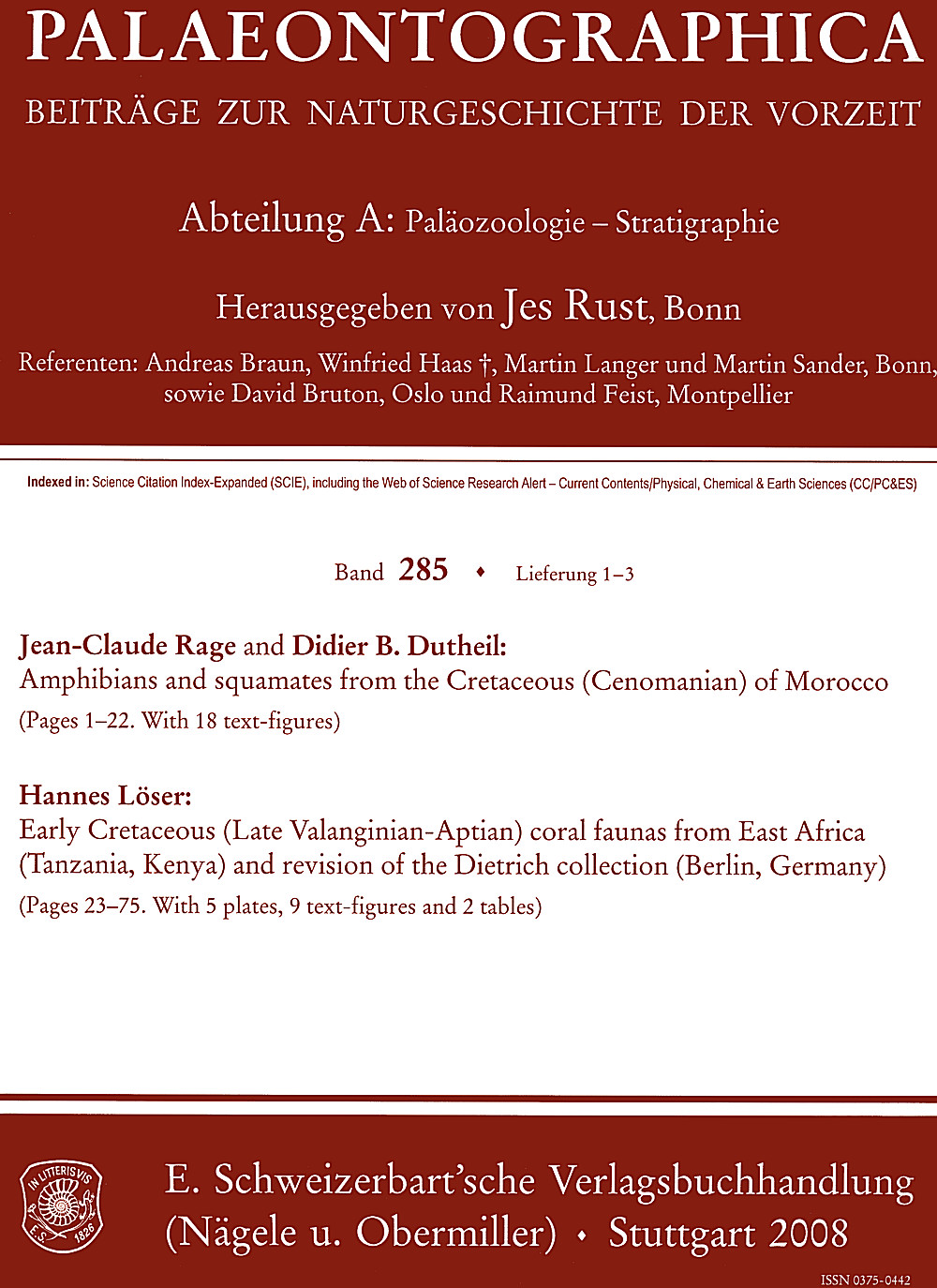MARIUSZ SALAMON und sein Team beschäftigen sich intensiv mit der
Crinoidenfauna im Mesozoikum von Polen und publizierten bereits viele
ihrer Ergebnisse. Ihre Spezialität ist das Schlämmen sehr großer
Sedimentmengen – auch für die vorliegende Arbeit wieder 1-2 Tonnen –,
das akribische Auslesen der oft sehr kleinen und zum Teil sehr
seltenen Skelettelemente der disartikulierten Crinoiden und deren
systematisch-taxonomische Bestimmung, knappe Beschreibung und
fotografi sche Dokumentation. Regelmäßig entdecken die Autoren dabei
Taxa, die früheren Bearbeitern aufgrund der Unscheinbarkeit und
Seltenheit vieler Funde entgangen sind. Die Bestimmung ist allerdings
nur manchmal bis zum Speciesniveau möglich; oft muss man sich mit der
Gattung oder Familie begnügen. Zudem ist das stratigraphische Raster
der Proben relativ grob, oft nur auf die Stufe oder Unterstufe genau.
Aber insgesamt kam in relativ kurzer Zeit ein erstaunlich
umfangreicher Datensatz zusammen, der den „Fossil Record“ erheblich
erweitert hat. Vor allem aber dehnte sich die bekannte
stratigraphische Reichweite einer Reihe von Crinoidentaxa um
unerwartet lange Zeitspannen aus.
Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit sind neben Cyrtocriniden aus dem
Bathonium (nur eine Art) vor allem solche aus dem Callovium von Polen
außerhalb der Karpaten. Von hier werden neun Taxa, zum Teil in
offener Nomenklatur, erstmals beschrieben. Davon ist Fischericrinus
ausichi n. sp. neu, allerdings mit unsicherer
Familienzuordnung. Cyrtocriniden aus dem Oxfordium und
Unter-Kimmeridgium sind kürzer und ohne Abbildungen beschrieben, weil
das Autorenteam diese in einer etwa zeitgleich erschienenen
Parallelarbeit ausführlicher behandelt. SALAMON stellt die
außerkarpatischen Funde der bereits länger bekannten, weitaus
artenreicheren Cyrtocrinidenfauna aus den Karpaten gegenüber. Außerdem
befasst sich die vorliegende Arbeit auch mit den Isocrinida Polens aus
Oxfordium und Kimmeridgium, obwohl diese im Titel nicht genannt sind.
Die morphologischen Beschreibungen sind sehr knapp, wie beim
Autorenteam von SALAMON üblich. Dagegen beanspruchen die Auflistungen
der rohen Messdaten relativ viel Raum. Diese Listen sind
unanschaulich, weil die Exemplare nicht etwa nach zu- oder abnehmender
Größe, sondern nach Inventarnummern angeordnet sind.
Leserfreundlicher wäre es gewesen, die Daten graphisch darzustellen,
zum Beispiel als Punktwolken in Koordinatensystemen.
Die Fossilfotos sind scharf; ihre Wiedergabe hätte im Druck etwas
kontrastreicher sein dürfen. Wegen der Seltenheit einiger Taxa kann
man jedoch nicht nur Fotos von makellos erhaltenen Skelettelementen
erwarten.
Neben Systematik und Stratigraphie sind Faunenwanderungen ein
Arbeitsschwerpunkt von SALAMON. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit
bestätigen für die meisten Arten die schon in früheren Arbeiten des
Autorenteams postulierte vorherrschende Wanderungsrichtung der
Crinoiden von der Tethys im Süden ins Epikontinentalmeer im
Norden. Drei Arten zeigen allerdings ein abweichendes
Verbreitungsmuster in Raum und Zeit. Fünf paläogeographische Kärtchen
stellen die Vorkommen jeweils einer Art in jeweils zwei
Zeitabschnitten dar und veranschaulichen so die postulierten
Faunenwanderungen.
Schließlich diskutiert der Verf. noch die Bedeutung der Funde aus
Polen für die Phylogenie der Cyrtocriniden im Mittel- und Ober-Jura.
Fazit: Die vorliegende Arbeit ist wichtig und fügt sich formal und
inhaltlich in eine ganze Reihe von ähnlich aufgebauten Arbeiten des
Autorenteams ein. Wie bereits in früheren Publikationen liefert
SALAMON auch diesmal wieder einen umfangreichen Satz von
Daten-Bausteinchen zum „Fossil Record“. Dank SALAMON fügen sich diese
Datensätze im Lauf der Zeit zu einem erstaunlich umfang- und
informationsreichen Daten-Mosaik zusammen, das unsere Kenntnis über
die Crinoidenfauna im Mesozoikum von Polen und seinen Nachbargebieten
innerhalb weniger Jahre vervielfachte.
M. JÄGER
Zentralblatt Geol. Pal. T. II, Jg. 2009/5-6