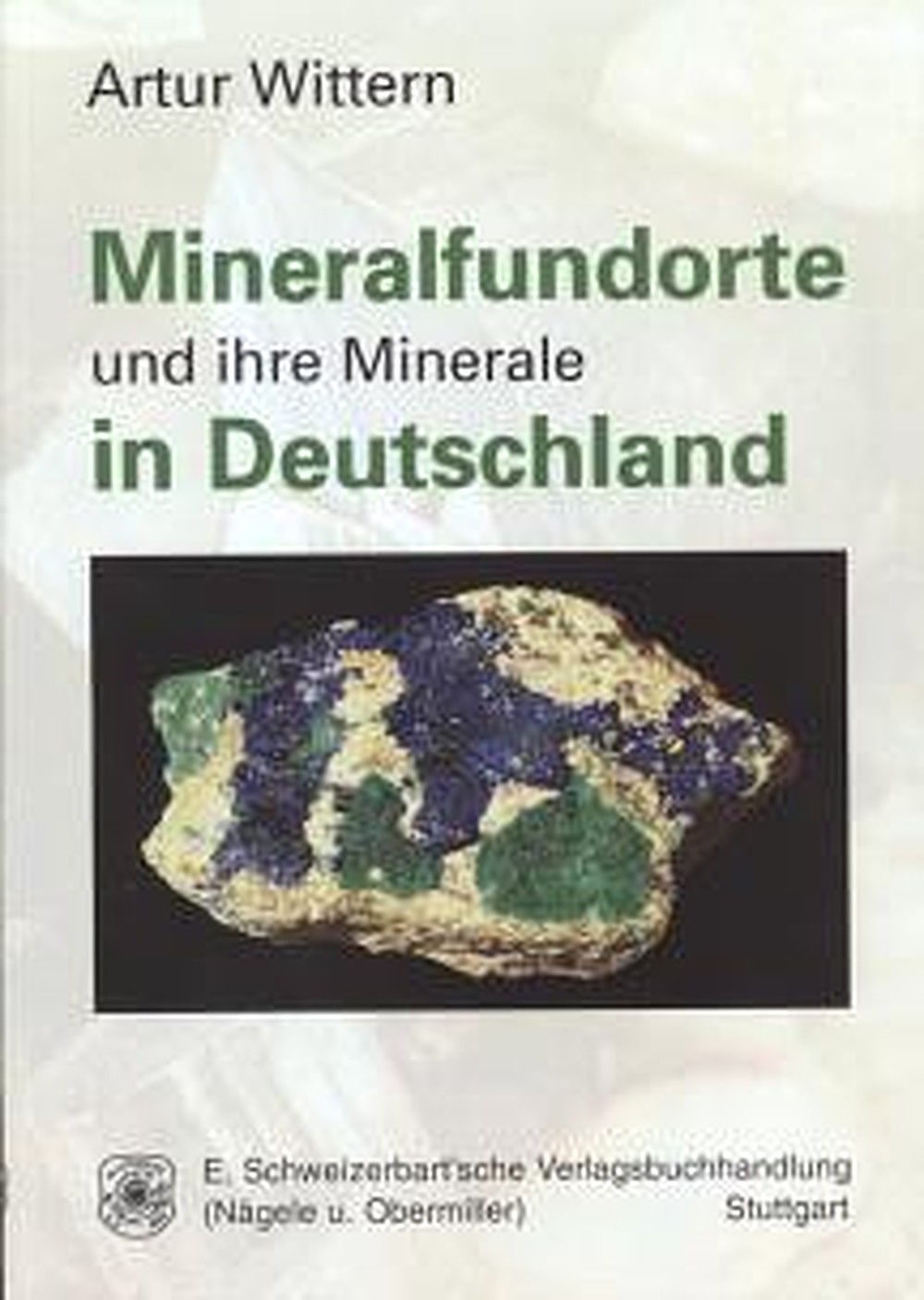Als Wittern vor wenigen Jahren ein Buch mit dem Titel "Freude an
Steinen in Schleswig-Holstein und im Raum Hamburg" verfaßte, erntete
er heftige berechtigte Kritik, nicht nur wegen der vielen Fehler und
Unzulänglichkeiten, die in Wort und Bild enthalten waren. Die Kritik
bezog sich auch auf die Tatsache, daß bei dem vielen Abschreiben und
Abfotografieren weder Roß noch Reiter genannt wurden. Diesen letzten
Punkt hat sich der Autor bei dem nun vorliegenden Werk doch zu Herzen
genommen, davon zeugt ein umfangreiches Literaturverzeichnis, das
gleichzeitig eine enorme Flei?arbeit belegt.
Es war sicher eine gute Idee, die Fundorte der Minerale in
Gesamtdeutschland einmal zusammenzustellen. Für den aktiven Sammler
ergibt sich in der praktischen Anwendung dieses Fundstellenf?hrers
allerdings eine erhebliche Einschränkung: von den etwa 500
beschriebenen Fundstellen bzw. Fundgebieten entfallen rund 50 % unter
die Rubrik "aufgelassen, erloschen, Naturschutzgebiet".
Die Angaben zur Geologie in den jeweiligen Fundgebieten sind kurz,
aber zum Verständnis der Zusammemhänge absolut ausreichend. Mit der
Beurteilung des wohl wichtigsten Kriteriums bei der Beschreibung der
Fundstellen, nämlich der Aktualität und Richtigkeit der Aussagen, tut
sich jeder Rezensent schwer, ist ihm doch immer nur ein Teil der
Fundorte von eigener Anschauung her bekannt.Dennoch ein Beispiel: im
Fall Idar-Oberstein fällt auf, daß der Autor im Bezug auf den
Steinbruch Juchem zwar auf dem neuesten Stand ist, in zwei anderen
Fällen jedoch völlig daneben liegt. Den Steinbruch Setz bevölkern die
Sammler bestimmt nicht mehr, denn er ist bereits seit 1986 stillgelegt
und gibt nichts mehr her und das Deutsche Edelsteinmuseum befindet
sich seit etlichen Jahren nicht mehr im Börsenhochhaus, sondern in
einem anderen repräsentativen Geb?ude der Stadt.
Angaben zum aktuellen Stand der Begehungsmöglichkeiten werden nur in
ganz wenigen Fällen gemacht. Das ist in jedem Fall ein Manko, bei der
umfangreichen Recherche hätten dazu eigentlich deutlich häufiger
Angaben gemacht werden müssen, auch wenn diese Daten sich genauso
schnell ändern können wie die Fundmöglichkeiten. In mehreren Fällen
werden relativ viele Worte über einen einzigen Fund an einem
bestimmten Ort verloren. Muß man da schon von einem Fundort im Sinne
des Mineraliensammlers sprechen?
Der Sinn der häufigen Computerzeichnungen idealisierter Kristalle ist
nicht ganz einzusehen. Eine Prachtstufe wie im Fall der dargestellten
Jeremejewitkristalle vom Emmelberg dürfte es wohl kaum gegeben
haben. Und wenn der Autor in diesem Zusammenhang sein eigenes Werk als
"Malbuch" anpreist, dann verstehe das wer will. Auch die Gedankengänge
über die Bildung der Calcitkristalle in den Gaskammern von
Cephalopoden - und damit den Ausflug in die Paläontologie - hätte der
Autor vielleicht besser für sich behalten. Schade eigentlich, denn
solche Dinge mindern den Wert des mit sehr viel mineralogischem
Sachverstand erstellten Buches.
Für den Bewohner und Sammler des norddeutschen Flachlandes ist es
immerhin erfreulich, daß hier erstmals in einem Fundstellenführer auch
die Mineralien aus den nordischen Geschieben Erwähnung finden.
Das vorliegende Buch dürfte im wesentlichen als Nachschlagewerk
geeignet sein, zumal wegen der vielen aufgeführten historischen
bzw. erloschenen Fundorte. Der aktive Sammler kann selbstverständlich
nachlesen, was es in den noch begehbaren Steinbrüchen denn zu finden
gibt, bei einiger Erfahrung weiß er aber, daß er seine Erwartungen
nicht zu hoch ansetzen darf und oft enttäuscht wird. Im übrigen dürfte
er meistens über fundortbezogene Literatur verfügen. - Das Buch ist
sauber aufgemacht, der Preis ist angemessen.
Rudolf Mende
Der Geschiebesammler, Jg. 35, Heft 2, Juni 2002