Inhaltsbeschreibung top ↑
Eine farbige Beilage korrelliert das Quartär und die Eisvorstöße in NW-Europa, Norddeutschland, dem nordwestlichen Alpenvorland und dem nordöstliche n Alpenvorland.
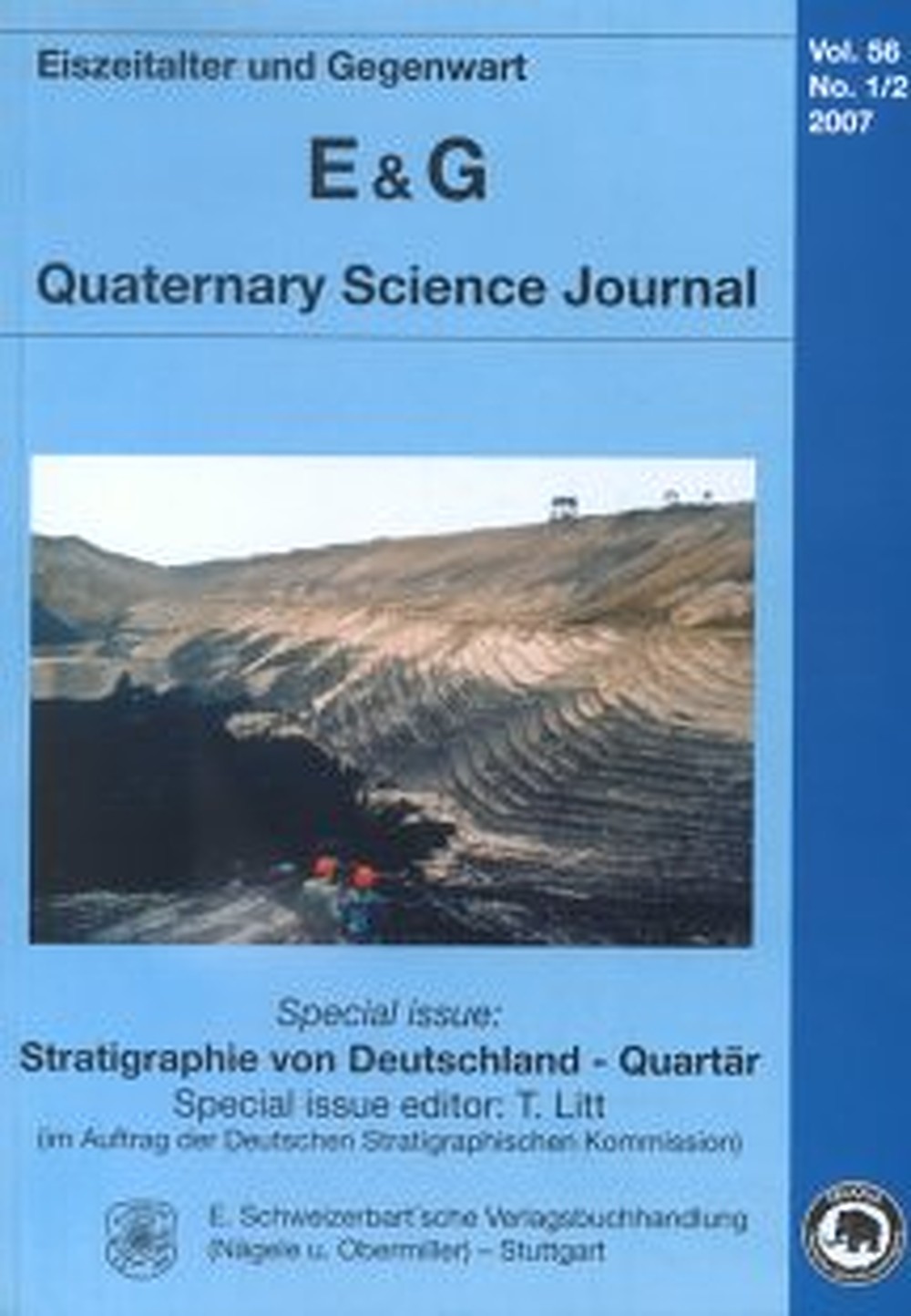
Hrsg.: Thomas Litt; Deutsche Quartärvereinigung e. V. Hannover
2007. 138 Seiten, 6 Abbildungen, 2 Tabellen, 17x24cm, 510 g
Language: Deutsch
(Eiszeitalter und Gegenwart, Band 56 No. 1/2)
ArtNo. ES187005600, brosch.
Internal article
Im Vergleich der Abfolge von Warm und Kaltzeiten in den verschiedenen Regionen Deutschlands wird schnell und unvermeidlich das größte Problem der deutschen Quartärgeologie deutlich. Kaltzeiten wie Mindel oder Günz aus dem mittleren oder frühen Pleistozän werden zum Teil zeitlich völlig unterschiedlich eingestuft. Es fehlt in Deutschland ganz offensichtlich an langen kontinuierlichen Kernen mit kalt- und warmzeitlichen Sedimenten in Superposition. Darüber hinaus gibt es unterhalb der Brunhes Matuyama Grenze (ca. 780.000 Jahre v.H.) keine Datierungen in den Sedimenten des Frühpleistozäns und Pliozäns.
Der nun vorliegende Sonderband zur „Stratigraphie von Deutschland – Quartär“ kann all diese offenen Fragen natürlich nicht aufgreifen und zu einer Lösung bringen. Es fehlen dafür vor allem die zuverlässigen Datierungsmethoden. Hier besteht in der Quartärgeologie wohl der größte Handlungsbedarf. In den letzten Jahren sind insbesondere im Oberrheingraben vielversprechende, lange Kerne bis in das Pliozän schon erbohrt worden; ohne neue Entwicklung in dem Forschungsfeld der Geochronologie wird sich die Stratigraphie und Klimaentwicklung des frühen Pleistozäns aber nicht aufbauen lassen.
Es ist das Verdienst der Autoren, mit dem vorliegenden Sonderband eine Grundlage geschaffen zu haben, um das nomenklatorische Wirrwarr der Quartärwissenschaften in eine nachvollziehbare Bestandsaufnahme zu überführen. Auf dieser Basis wird es nun hoffentlich möglich sein, in den kommenden Jahren die Klimageschichte Deutschlands durch das mittlere und frühe Quartär bis in das Pliozän zurückzuverfolgen, um diese Zeit (in der das atmosphärische CO2 deutlich höher gewesen sein muss als heute) als vermutlich bestes Analog für die mögliche Klimaentwicklung der kommenden Jahrhunderte zu erforschen.
Frank Sirocko, Mainz
GMIT Nr. 30 (Dezember 2007)
Das Quartär in Deutschland wird geprägt durch die pleistozänen Vereisungen und deren Ablagerungen. Im Vorwort wird auf die Probleme der Quartärstratigraphie in Deutschland eingegangen. Es wird im wesentlichen eine klimatostratigraphische Gliederung vorgestellt. Geographisch und historisch bedingt erfolgten unterschiedliche Gliederungen für Norddeutschland (skandinavische Gletschervorstöße) und Süddeutschland (Alpengletscher). Die Diskussion über die lokalen Einheiten und deren Korrelation ist noch nicht abgeschlossen, weshalb ein Zwischenstand vorgelegt wird. Lithostratigraphische Einheiten sind noch nicht endgültig definiert worden, so dass dieser Band nur klimatostratigraphische Einheiten mit deren Typusgebiet vorstellt. Ergänzend werden Daten zur Magnetostratigraphie genannt.
Ein Einführungskapitel stellt das Quartär als chronostratigraphische Einheit vor. Begriffe wie Glazial, Interglazial, und die Untereinheiten Stadial und Interstadial werden definiert.
Wichtigstes Kriterium ist die Temperaturbestimmung (Klimatostratigraphie!) mit Hilfe der Pflanzengesellschaften (Blätter, Pollen). Die Abgrenzung der Periode Neogen zum Quartär bzw. zwischen den Epochen Pliozän und Pleistozän ist zwar durch einen GSSP (Global Stratigraphic Section and Point = Grenzstratotyp-Profil und Grenzstratotyp-Punkt) in Italien festgelegt, aber immer noch umstritten. Die Grenze zwischen Pleistozän und dem Holozän (ein Interglazial!) ist noch nicht verbindlich festgelegt.
Die Hauptkapitel heißen und behandeln entsprechend der geographischen Trennung der Vereisungsgebiete ”Stratigraphische Begriffe für das Quartär des norddeutschen Vereisungsgebietes“, ”Stratigraphische Begriffe für das Quartär des süddeutschen Alpenvorlandes“ und ”Stratigraphische Begriffe des Quartärs des Periglazialraums in Deutschland“. Es folgen jeweils standardisierte Beschreibungen der Einheiten.
Ein übergeordnetes säugetierstratigraphisches Kapitel ergänzt sinnvoll die klimato-, litho- und morphostratigraphischen Beschreibungen der räumlich getrennten Bereiche.
Die Autoren merken selbstkritisch an, dass in Zukunft eine reine Lithostratigraphie, auch unabhängig der historisch geprägten Begriffe, dringend vonnöten wäre. Ergänzend bleibt anzumerken, dass ein vorgeschlagene Parastratotyp für das Holozän, nämlich die Abfolge in Eifelmaaren, durch Störungen der ”hohen Präzision ... von jährlich geschichteten lakustrinen Ablagerungen“, kritisch zu sehen ist (vgl. SUHR et al. 2006).
Das Buch ist ein Nachschlagewerk für stratigraphische Begriffe und Datierungen der jüngsten Erdgeschichte und als solches sowohl für Fachleute als auch für naturkundlich interessierte Laien zu empfehlen.
Thomas Schindler, Spabrücken
Mitt. POLLICHIA 93
Die einzelnen Beiträge sind einheitlich in die Punkte Definition, Erstbeschreibung, Typuslokalität Verbreitung und Datierung gegliedert. Der Punkt Bemerkungen zeigt bestehende Probleme auf. Der vorliegende Band berücksichtigt die Begriffe für das Quartär des norddeutschen Vereisungsgebietes, des süddeutschen Alpenvorlandes, klimatostratigraphische Begriffe aus dem Periglazialraum sowie Begriffe aus der Säugetierpaläontologie. Lithostratigraphische Begriffe ließ man weg. Diese sollen später in einem Lithostratigraphischen Lexikon veröffentlicht werden, das die Subkommission Quartär zur Zeit erarbeitet. Alle Beiträge sind in Deutsch verfasst, ergänzt durch lange englischsprachige Zusammenfassungen. Auf das Vorwort des Herausgebers, der auch Vorsitzender der Subkommission der Deutschen Stratigraphischen Kommission ist, folgen fünf Beiträge und ein gemeinsames Literaturverzeichnis:
Im Beitrag von LITT, T., Das Quartär als chronostratigraphische Einheit weist der Autor auf die entscheidende Bedeutung des Klimawechsels für die Gliederung Lehrbücher, zusammenf. Darstellungen, Bibliographien 733 des Quartärs hin. Die Klassifikation auf der Grundlage von klimastratigraphischen Einheiten wie Glaziale und Interglaziale hat eine lange Tradition und ist in verschiedenen Ländern bzw. Regionen in chronostratigraphischen Standards verankert. Der Verf. führt verschiedene Definitionen für Interglazial, Glazial, Interstadial, Thermomer und Kryomer auf. Aufgrund der starken räumlichen und zeitlichen Variabilität des Klimas ist die Entwicklung regionaler Stratigraphien mit entsprechenden Stratotypen für das Quartär insbesondere im kontinentalen Bereich unabdingbar. Zahlreiche regionalstratigraphische Einheiten und Grenzstratotypen des Quartärs legte man in Europa mittels palyno-stratigraphischer Kriterien fest. Der Autor schildert auch die Probleme bei der Festlegung der Untergrenze des Quartärs und bei dessen Untergliederung. In jüngster Zeit diskutiert man auch der Status des Quartärs als formale stratigraphische Einheit im Sinne einer geologischen Periode. Die Vorschläge reichen von der gänzlichen Aufgabe des Begriffs Quartär und dessen Einbeziehung in das Neogen bis zur Beibehaltung als eigenständiger Periode mit der Gauss/Matuyama-Grenze unter Einbeziehung des Gelasium als Untergrenze. Der Autor favorisiert letztern Vorschlag.
Es folgen von LITT, T., BEHRE, K.-E.,MEYER, K.-D., STEPHAN, H.-J.&WANSA, S. Stratigraphische Begriffe für das Quartär des norddeutschen Vereisungsgebietes und von HABBE, K. A. (unter Mitarbeit von ELLWANGER, D. & BECKER-HAUMANN, R.) Stratigraphische Begriffe für das Quartär des süddeutschen Alpenvorlandes.
URBAN, B. liefert Stratigraphische Begriffe für das Quartär des Periglazialraumes in Deutschland.
In diesen drei Beiträgen werden nach der oben genannten einheitlichen Gliederung die stratigraphischen Begriffe der jeweiligen Gebiete beschrieben und diskutiert. HABBE stellte seinem Beitrag allgemeine Überlegungen zur morphostratigraphischen Gliederung der pleistozänen Ablagerungen des Alpenvorlandes und zur Systematik der morphostratigraphischen Definition stratigraphischer Begriffe voran. Der Beitrag von URBAN deckt nicht den ganzen Periglazialraum Deutschlands ab und endet im frühen Mittel-Pleistozän mit der Mauerer Waldzeit. Er beinhaltet die Gliederung in der Niederrheinischen Bucht, Teile von Rheinland-Pfalz (Kärlicher Interglazial) und Mauer (Mauerer Walzeit). Der Titel ist insofern irreführend, als der Eindruck entsteht, dass die Verf. Gliederungen des gesamten deutschen Periglazialraums anbieten.
Im Artikel Biostratigraphische Begriffe aus der Säugetierpaläontologie für das Pliozän und Pleistozän Deutschlands von KOENIGSWALD, W. VON & HEINRICH, W.-D. basiert die säugetierpaläontologische biostratigraphische Gliederung des für das Pliozän und Pleistozän in Deutschland im Wesentlichen auf der Abfolge von Wühlmaus-Gattungen, mit den sich Superzonen und Biozonen unterscheiden lassen. Bei einer Gesamtdauer des Quartär von nur rund zwei Millionen Jahren sind keine großen evolutiven Veränderungen zu erwarten. Daher werden das gemeinsame Vorkommen von verschiedenen Arten und deren erst- und letztmaliges Auftreten zur Charakterisierung der biostratigraphischen Zonen verwendet. Der vielfache Austausch, der besonders die großen Pflanzenfresser betraf, ist klimatisch gesteuert.
Die Vielzahl der in den Beiträgen erläuterten Begriffe spiegelt die starken regionalen Unterschiede wieder und erklärt, warum es so schwierig, oft unmöglich ist, über größere Entfernungen die Warm- und Kaltzeiten aus verschiedenen Gebieten miteinander zu korrelieren.
Der Band stellt den gegenwärtigen Forschungsstand dar, zeigt aber auch die Forschungslücken auf und ist für den Quartärgeologen/-paläontologen ein unentbehrliches Werk.
R. ZIEGLER
Zentralblatt Geo. Pal. T. II Jg. 2007 H. 5/6