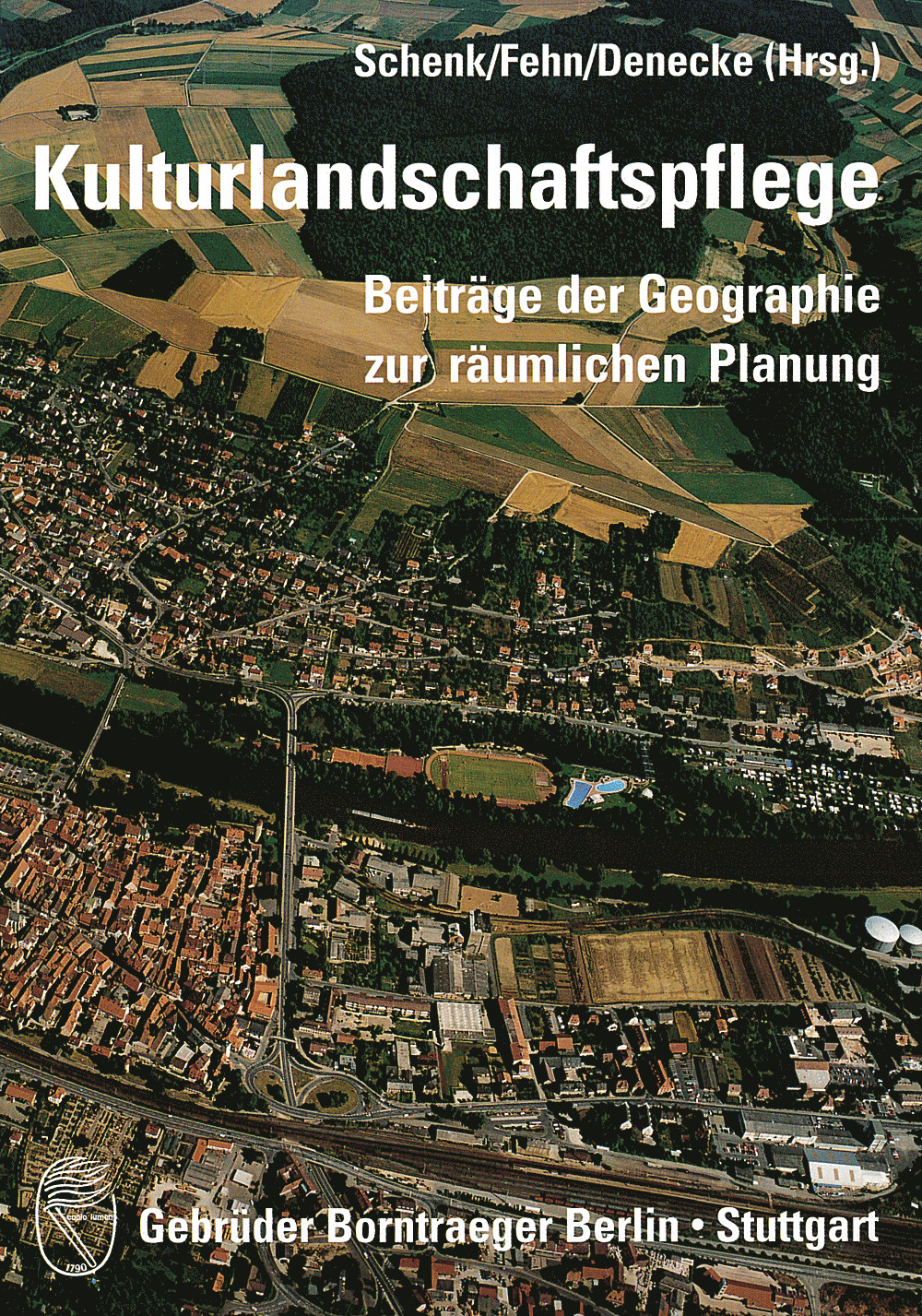Seit Jahrzehnten gehört es zum Grundbestand sozialgeographischer Erkenntnisse,
daß Raumstrukturen und räumliche Prozeßabläufe in starkem Maße von
gesellschaftlichen Entwicklungen abhängig sind. Es verwundert daher
nicht, wenn der Wandel von Kulturlandschaften gerade in der gegenwärtigen Zeit
rascher Veränderungen zum besonderen Studienobjekt geographischer Forschungen
wird. Dies ist auch der Hintergrund des in weiten Teilen kulturhistorisch
ausgerichteten Sammelbandes, der hier zu besprechen ist.
Unter der Herausgeberschaft dreier Wissenschaftler werden Arbeitsergebnisse
und Einzelstudien von Autoren vorgelegt, die den Beitrag der geographischen
Wissenschaften zum o.a. Thema verdeutlichen wollen. In starkem Maße fließen
dabei Arbeitsergebnisse ein, die aus den Diskussionen des 1994 von Geographen
begründeten Arbeitskreises ``Kulturlandschaftspflege'''' initiiert wurden.
Der Sammelband umfaßt 45 Beiträge, die in sechs Kapiteln zusammengefaßt sind:
1. Was ist Kulturlandschaftspflege?
2. Methodik und rechtlicher Rahmen der
Kulturlandschaftspflege.
3. Kulturlandschaftspflege auf der Ebene
von Gemeinde und Gemarkung.
4. Kulturlandschaftspflege im regionalen
Bezug.
5. Kulturlandschaftspflege auf der Ebene
der Bundesländer und Staaten.
6. Fachübergreifende Beiträge zur Kulturlandschaftspflege auf der Basis
kulturgeographischer Grundlagenforschung.
Eine Auswahlbibliographie und ein Orts- und Sachregister beschließen den Band.
In Anbetracht der großen Zahl von Beiträgen ist eine Einzelwertung im
vorgegebenen Rahmen nicht möglich. Die Zielstellung der Publikationen ergibt
sich aus der Formulierung ``das in der Geographie in großer Dichte
vorhandene Wissen zum planerisehen Umgang mit Kulturlandschaften (zu)
präsentieren''''. Es sollen vor allem ``Planer in Behörden, einschlägigen
Institutionen und Büros, die sich mit Kulturlandschaften auseinandersetzen,
diesen Ansatz als bedeutsam kennen und in der Planungspraxis berücksichtigen''''
(S. 5).
Von zentraler Bedeutung sind die einleitenden Kapitel 1 und 2, die sich mit
terminologischen und methodologischen, für den Sammelband rahmensetzenden
Fragen im Hinblick auf die Pflege der Kulturlandschaft beschaltigen Erfreulich
erscheint, daß keineswegs nur die Konservierung überkommener Landschaften und
Einzelelemente behandelt wird, sondern - trotz starker kulturhistorischer
Ausrichtung des gesamten Bandes - auch deren Weiterentwicklung. Auf der
Grundlage detaillierter Regionalkenntnisse werden zahlreiche Fallstudien im
Hinblick auf das Rahmenthema erläutert. Sie reichen u.a. vom
museumsdidaktischen Weg zur Kulturlandschaft bis zur Problematik der
Konversion militärischer Liegenschaften, von der
Kulturlandschaftsinventarisation bis zur Baudenkmalpflege, wobei mit diesen
wenigen Aspekten die gesamte Breite der Darstellungen noch nicht ausgeleuchtet
ist.
Die Erkenntnis von der Notwendigkeit der Kulturlandschaftspflege ist nicht
jungen Datums. Sie gewinnt jedoch zu Beginn der 2. Hälfte dieses Jahrhunderts
neue Bedeutung, u.a. mit der Nichtnutzung landwirtschaftlicher Nutzflächen,
den Ansprüchen des Tourismus usw. Keineswegs setzt der auflkommende
Umweltschutzgedanke den ersten Anstoß, wie zahlreiche Beispiele z. B. aus dem
nur wenig beachteten Alpenraum zeigen. Gerade von Geographen Ende der
60er/Anfang der 70er Jahre erstellte Gutachten für staatliche Behörden (z.B.
Bergbauerngebiet der Alpen) oder gemeinsam mit Ökologen und Ökonomen erstellte
Planungsgrundlagen zur Entwicklung der Kulturlandschaft in Bayern usw. griffen
damals das Thema Kulturlandschaftspflege auf. Dies gilt auch für die lebhafte
praxisorientierte Diskussion um die Pflegedienste, die bereits in den SOer
Jahren (Sozialbrache!) ihren Anfang nahmen. Der Weg der Angewandten
Sozialgeographie war längst eingeschlagen. Schließlich wurde auch bereits 1970
gesetzlich der Landwirtschaft die Aufgabe der Erhaltung der Kulturlandschaft
bzw. der Landschaftspflege zugewiesen (Bayern 1970, Baden-Württemberg 1972).
Stellt man den Inhalt des Sammelbandes - nicht ``Handbuch'''' im Sinne einer
Zusammenfassung eines Wissensgebietes oder gar Nachschlagewerks - den beiden
im Geleitwort genannten Zielen der Publikation gegenüber, dann ist das zweite
Anliegen, ``grundlegende Diskussion um Methoden-, Werte- und
Maßstabsfragen beim Umgang mit Kulturlandschaften auf der Basis reichlich
vorhandenem Wissens... zu befördern'''', voll erfüllt worden. Der Beitrag
bestätigt auch, daß das zeitweise in der Geographie vorherrschende Bestreben,
nämlich die Betrachtung konkreter landschaftlicher Strukturen in den
Hintergrund treten zu lassen, für die Anwendung geographischer Erkenntnisse in
der Öffentlichkeit eine Sackgasse vvar. Das vorliegende Buch zeigt eimnal
mehr, daß Kenntnisse räumlicher Organisationsformen und raumbedeutsamer
Prozesse unverzichtbare Grundlagen fur die Gestaltung eines Lebensraumes sind.
Die Bewertung des ersten Zieles, ``einen praxisorientierten, gesetzlich
geforderten und auf unmittelbare Anwendung ausgerichteten Beitrag (zu)
leisten'''', wird dagegen nicht in gleicher Weise erfüllt. Hier fehlt z. B. eine
einfache allgemeine Anleitung über Verfahrensweisen, Kritik bisheriger
Richtwerte und ein stärkeres Eingehen auf die Nachbarwissenschaften, die in
der räumlichen Planung ein wichtige Rolle spielen.
Auch verfügen wohl nicht alle Autoren über die notwendige
"Praxisnähe". Hierbei hätte eine systematische Aufarbeitung der
Planungsliteratur, Landesentwicklungsprogramme usw., aber auch eine
Durchforstung der Vielzahl von Förderansätzen noch eine wesentliche Ergänzung
bringen können.
So ist das Verdienst der Autoren vor allen Dingen in der Behandlung
verallgemeinerter Fragestellungen z.B. im . und 2. Kapitel, in der Darlegung
der Vielzahl von Forschungsansätzen und vereinzelter Lösungsmögliclichkeiten
zu sehen sowie in der Anregung, über dieses unerschöpfliche Thema weiter
nachzudenken.
Dr. Karl Ruppert (München)
Raumforschung und Raumordnung, 1. 1999, Rubrik "Neue Literatur", Seite 63