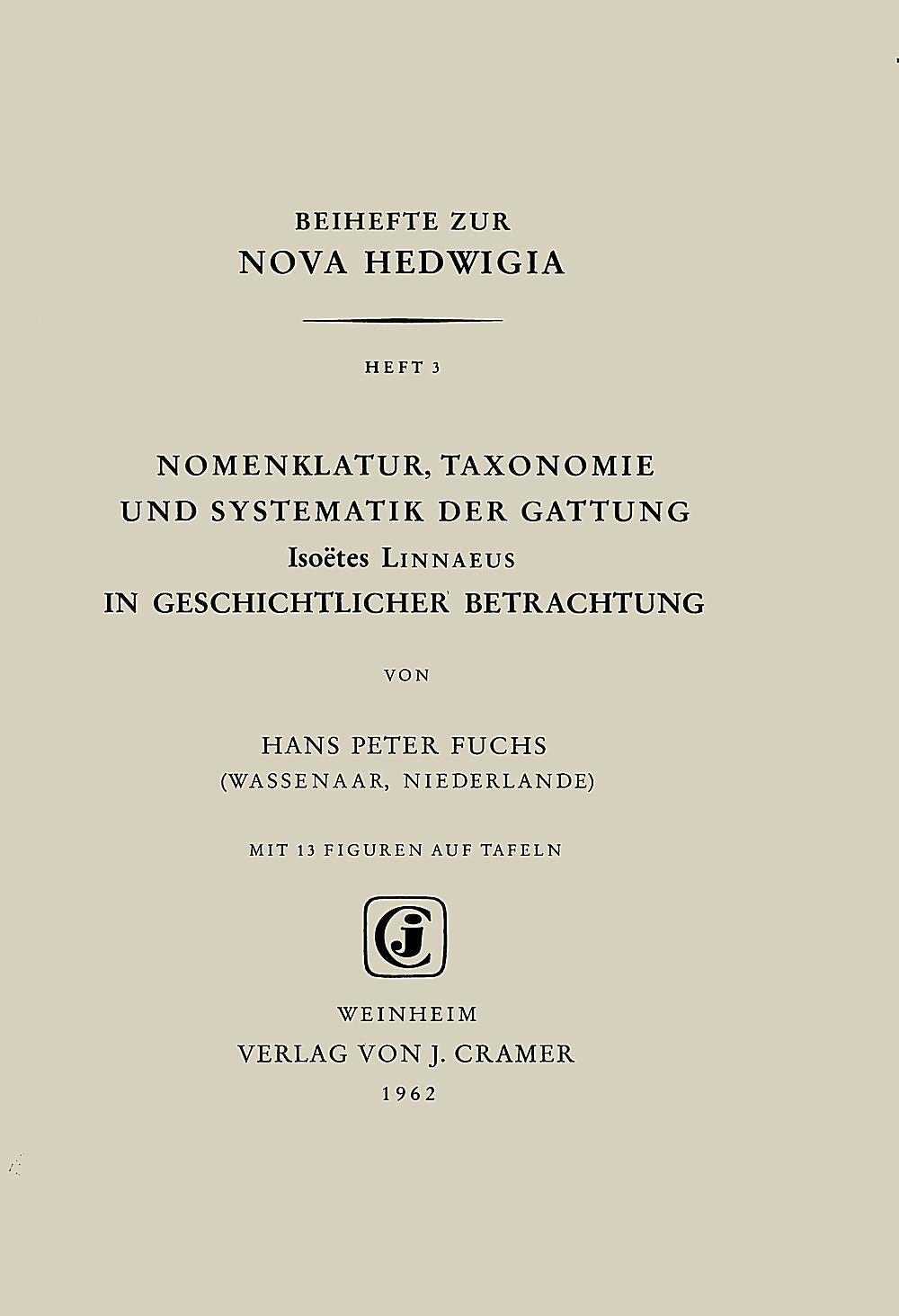Inhaltsbeschreibung top ↑
Die vorliegende Arbeit war ursprünglich lediglich als vorbereitende
Studie zu einer kritischen pflanzengeographischen und floristischen
Bearbeitung der Gefäßkryptogamen der Ossolatäler in Italien gedacht.
Wegleitend war dabei die Überlegung, daß eine
floristisch-phytogeographische Monographie auch eines relativ eng
begrenzten Gebietes in möglichst vielen Belangen kritische Beiträge
liefern sollte. (Eine solche Forderung hat eine um so größere
Berechtigung, wenn es sich — wie im Falle der Ossolatäler — um ein
pflanzengeographisch als Verbindungsglied zwischen ost— und
westalpinen Elementen sowie zwischen insubrischem und hochalpinem
Florenbezirk wichtiges Gebiet handelt. Aus diesem Grunde wurde auch
auf die Nomenklatur besondere Sorgfalt verwendet, und die Benennung
der zu behandelnden Taxa basiert auf der Methode der nomenklatorischen
Typen. Die spezielle Problemstellung brachte es auch mit sich, daß in
dieser Studie in erster Linie das Augenmerk auf die in Mittel- und
Nordeuropa vorkommenden, im Gebiet der Ossolatäler im weiteren Sinne
(d. h. unter Einschluß der beiden Seenbezirke des Lago Maggiore und
des Lago d’Orta) tatsächlich gefundenen oder nur in der Literatur
angegebenen zwei Isoätes-Arten gerichtet wurde.
Der Umstand, daß viele — um nicht zu sagen die meisten — der nach I
753 binär benannten mitteleuropäischen Taxa bereits vor diesem
nomenklatorischen Stichdatum bekannt, mit multinominaler Formel
benannt und beschrieben waren, brachte es mit sich, daß die Autoren
mit und nach Carl Linnaeus [nach 1761 Carl von Linniä] den nach
unseren heute geltenden Nomenklaturregeln erstmals gültig
veröffentlichten Taxa nicht allein ein Binom zuordneten sowie eine
Diagnose beifügten, sondern gleichzeitig in Form von Synonymhinweisen
sich auf vorlinneische Beschreibungen bezogen. Dies bedingt jedoch
heute mehr denn je ein möglichst weitgehendes und vollständiges
Studium dieser vorlinneischen Autoren; nur dadurch besteht die
Möglichkeit, die heute unterschiedenen Taxa eindeutig zu typisieren
und zu benennen, und zwar bis hinunter zu den kleinsten
infraspezifischen Einheiten.
Da im Rahmen dieser Vorstudie neben den Nachforschungen nach den
verschiedenen nomenklatorischen Typen gleichzeitig auch sämtliche
gedruckten und — soweit möglidm — handschriftlichen Quellen beigezogen
werden mußten, wuchs die Arbeit weit über den ursprünglich
vorgesehenen Rahmen hinaus und ließ eine gesonderte Publikation als
wünschenswert erscheinen. Die rein historischen Tatsachen im
Zusammenhang mit der Entdeckungs- und wissenschaftlidaen
Entwicklungsgeschichte der Isoätiden wurden in Form einer Zeittafel
als Dissertationsteildruck zur Publikation gegeben [cf. H. P. Fuchs
1959: 205—232].
Die heute vorliegende Studie muß als Versuch angesehen werden, die
Typenmethode bis ins letzte Detail durchzuführen. Inwieweit die im
folgenden nied‘ergelegte Arbeitsmethode auch auf andere Taxa der
mitteleuropäischen Flora mit Erfolg angewandt werden kann, muß die
Zukunft weisen. Immerhin scheint es, daß eine solche historisch
fundierte, auf der Typenmethode aufbauende Arbeitsweise die beste
Möglichkeit bietet, zu einer wissenschaftlich verantwortbaren
Stabilisierung der botanischen Nomenklatur zu führen.