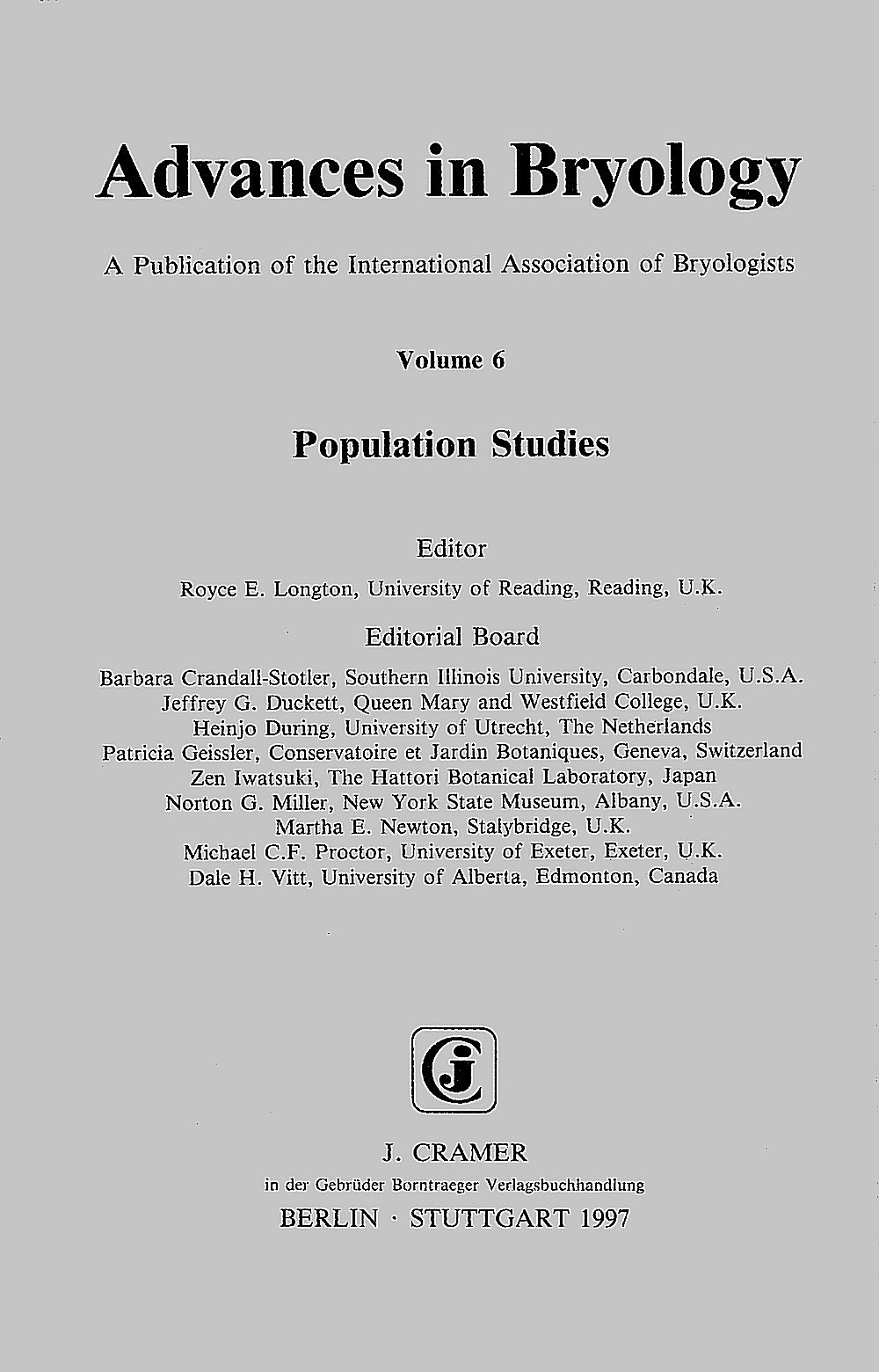Seit 1981 veröffentlicht die International Association of Bryologists
die Serie "Advances in Bryology". Die ersten beiden Bände wurden von
Wolfram SCHULTZE-MOTEL herausgegeben, die folgenden drei, nun jeweilen
einem bestimmten Thema gewidmet, von Norton G. MILLER, für den
(vorläufig) letzten zeichnet R. E. LONGTON verantwortlich. Ziel dieser
Serie ist, die neuesten Ergebnisse einer bestimmten bryologischen
Forschungsrichtung durch kompetente Fachleute zusammenfassen zu
lassen.
Populationsstudien geben uns nicht nur wichtige Einblicke in die
Biologie der Moose, die als haploide grüne Pflanzen eine besondere
Stellung im Pflanzenreich einnehmen, sondern sind auch unerlässliche
Grundlage für eine moderne Systematik. Der erste (und einzige
hepatikologische) Beitrag von H. BISCHLER und
M. C. BOISSELIER-DUBAYLE über Populationsgenetik und Variation bei
Lebermoosen behandelt gerade dieses Thema ausführlich, wie das
Erfassen der genetischen Variabilität zwischen und innerhalb von
Populationen zur Artabgrenzung benutzt werden kann. Die kürzlich
erfolgte Nachweis von Allopolyploidie bei Lebermoosen, vermutlich
nicht so selten wie früher vermutet, deutet auf die Wichtigkeit
solcher Prozesse bei der Artbildung hin. In Anhang wird eine
hervorragende Zusammenfassung der verschiedenen Techniken gegeben, die
in der molekularen Systematik gebraucht werden.
Im zweiten Artikel von A. J. SHAW und S. C. BEER über
Gametophyt-Sporophyt Variation und Kovariation bei Laubmoosen werden
zunächst die Konzepte "Fitness" und "Fortpflanzungserfolg" bei Moosen
und andern Embryophyten diskutiert, bevor die Kovarianz der beiden
Generationen anhand von zwei Modellen dargestellt wird. Das eine hat
gewöhnliche Kulturversuche eingebaut, das andere, aufwendigere,
experimentell kontrollierte Kreuzungen. Die Untersuchung der
genetischen Kovarianz zwischen den beiden Generationen muss die
Auftrennung in Merkmale berücksichtigen, die durch den mütterlichen
Gamelophyten beeinflusst sind, und jene, die sich in denselben Genen
beider Generationen ausdrücken.
R. E. LONGTON'S Beitrag behandelt Beziehungen zwischen
Fortpflanzungsbiologie und Lebensstrategien. Mit abnehmender
Lebensdauer des Gametophyten nimmt bei Kolonisten, Kurzlebigen und
Pendlern die Tendenz zu Monözie und grösserem Fortpflanzungsaufwand
zu. Anhand dieser und weiterer Analysen produktionsbiologischer
Faktoren werden Gründe für die Seltenheit bei Moosen diskutiert.
Die Rolle von Diasporenbanken für das Überleben von Moospopulationen
wird von H. J. DURING aufgeleuchtet, jene des Wettbewerbs, der
Konkurrenz, von H. RYDIN. Nancy G. SLACK stellt neuere Entwicklungen
in der Erforschung der Nischenbeziehungen bei Moosen vor, wobei auch
experimentelle Untersuchungen eingeschlossen sind.
L. SODERSTROM und T. HERBEN wenden Metapopulationmodelle zur
Darstellung moospopulationsdynamischer Prozesse an. Bis jetzt sind
aber dafür noch wenig Felddaten vorhanden.
Nach diesen allgemeinen Ausführungen wird der Band durch zwei
Fallstudien abgeschlossen. P. C. MARINO hat Wettbewerb, Ausbreitung
und Koexistenz von Splachnaceae in unregelmassig verteilten Habitaten
untersucht. Zwei Tetrapodon - Arten und zwei Splachnum - Arten können
durch Aufteilung der möglichen Habitate entlang eines
Feuchtegradienten oder durch jahreszeitliche Aufteilung
koexistieren. Die Populationsbiologie der Polytrichaceae von R. WYATT
und G. S. DERDA konzentriert sich vor allem auf populationsgenetische
Aspekte. Erfolgreiche Sporenkeimung konnte noch nicht nachgewiesen
werden. Trotz eingeschränktem Genfluss ist aber die genetische
Variabilität höher als für Organismen mit dominanter haploider
Generation erwartet würde, aber doch geringer als bei den meisten
anderen Moosen.
Es ist erstaunlich, dass auch für diesen Band eine Reihe
hervorragender Autoren gefunden werden konnte,. die mitten in der
Dynamik ihres Fachgebietes stehen. Im heutigen
wissenschaftspolitischen Umfeld, wo Forscher im Hinblick auf ihre
Karriere und ihr Überleben sich darauf konzentrieren müssen, in von
den Evaluationsbehörden anerkannten Zeitschriften zu publizieren, ist
es umso bemerkenswerter, dass es dem Herausgeber gelungen ist, die
kompetentesten Spezialisten für einen Beitrag zu gewinnen. Es wäre zu
begrüssen, wenn diese Serie auch in nichtbryologischen Kreisen gelesen
würde.
Patricia Geissler
Herzogia, Bd. 14, S. 229 (2000)