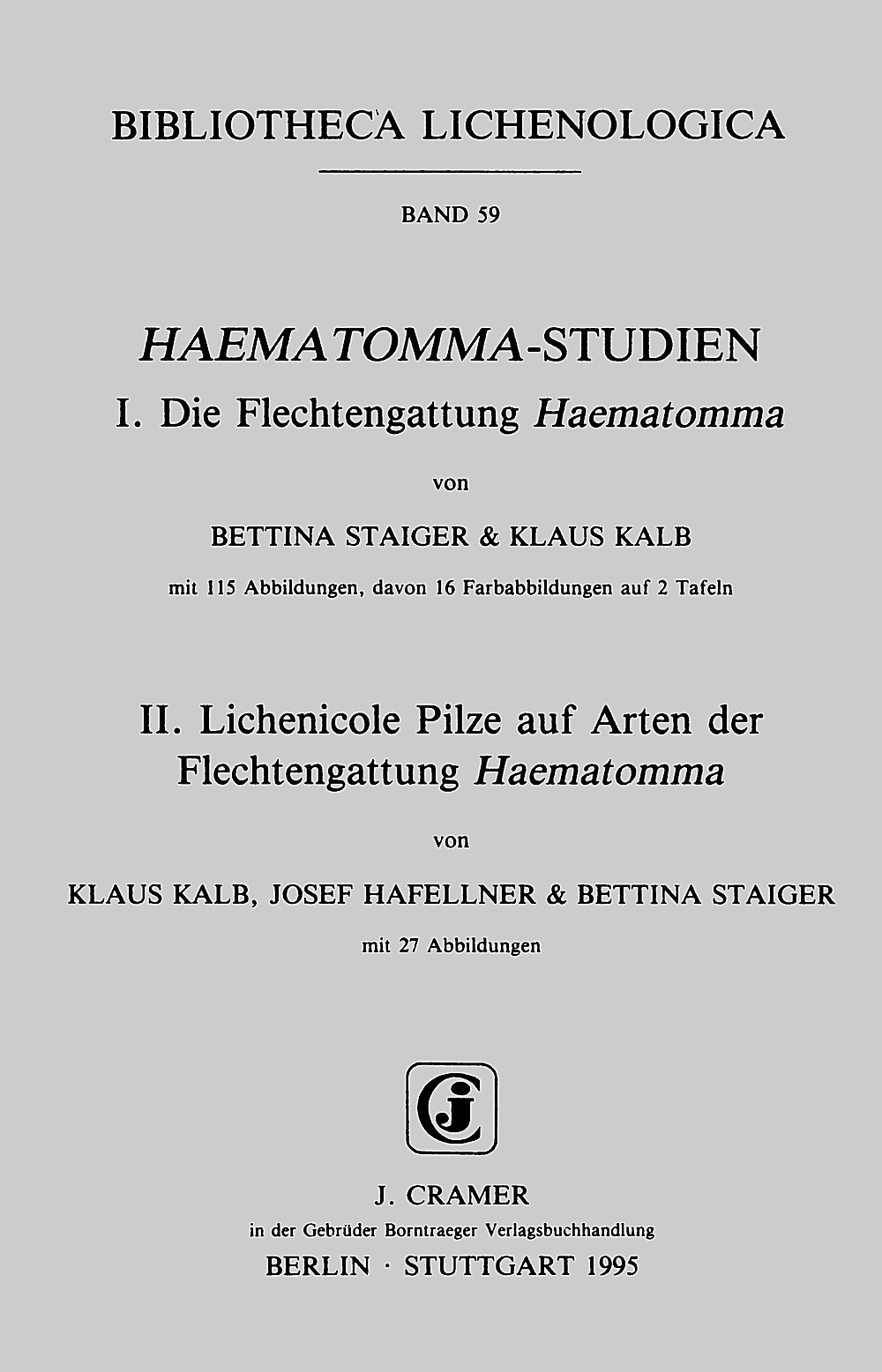Inhaltsbeschreibung Haut de page ↑
Nach chemischen und mikroskopischen Analysen von mehr als 1400
Flechtenproben aus allen Teilen der Welt und der Revision von 58 Taxa,
die als Haematomma beschrieben waren, wird eine Monographie
dieser Flechtengattung vorgelegt.
Haematomma sensu stricto umfaßt derzeit 35 Arten. Davon müssen
10 als für die Wissenschaft neu beschrieben werden: H. americanum,
H. brevisporum, H. cinchonarum, H. fluorescens, H. guyanense,
H. ivoriense, H. kenyense, H. matogrossense, H. nothofagi und
H. papuense.
Drei bislang subspezifische Sippen werden in den Artrang erhoben:
H. subpuniceum var. dolichosporum‚ H. puniceum var. subinnatum
und H. puniceum var. sulphureum.
In die Synonymie werden folgende 16 Arten verwiesen: H. brassii (= H.
persoonii), H. breviculum (= H. persoonii), H. bubalinum (= H. africa-
num), H. campanaense (= H. fenzlianum), H. coccineum (= H. persoonii),
H. dispersum (= H. fauriei), H. inexpectatum (= H. persoonii),
H. lydicum (= H. nemetzii), H. montevidense (= H. fenzlianum),
H. neglectum (= H. sorediatum), H. polycarpum (= H. persoonii),
H. pruinosum (= H. ere— maeum), H. saxicolum (= ernzlianum),
H. similis (= H. persoonii), H. subarthonioideum (= H. persoonii) und
H. subpuniceum (= H. fenzlianum).
Als zu anderen Gattungen bzw. Familien gehörig werden erkannt: H.
araucariae (= Ophioparma), H. brunneum (= Loxospora), H. californicum
(= Ophioparma), H. campaleum (= Bacidia), H. camptotheca (= Maronina),
H. Choisyi (= Bryonora), H. glaucomizum (= Loxospora), H. gypsophilae
(= aff. Toninia), H. oxneri (= Ophioparma), H. rappii (=
Opegraphaceae) und H. sordidum (= aff. Solenopsora).
Ein kritischer Vergleich der Ascusspitzen der Gattungen Loxospora,
Ophioparma und Haematomma hat ergeben, daß auch für
Loxospora eine eigene Familie beschrieben werden muß. Asci und
Paraphysen der drei noch vor kurzem in der Gattung Haematomma
vereinten Genera werden zeichnerisch dargestellt.
Je ein Bestimmungsschlüssel in deutscher und englischer Sprache soll
die Identifizierung aller anerkannten Arten erlauben, für die auch
eingehende Beschreibungen mit Sporenabbildungen und Verbreitungskarten
erstellt sind; erkennbare Verbreitungsmuster werden kurz diskutiert.
Die Untersuchung der Inhaltsstoffe mittels DC und HPLC hat fünf bisher
nicht bekannte Derivate der Placodiolsäure zu Tage gebracht, für die
ELIx (in litt.) folgende Namen vorgeschlagen hat:
Methylplacodiolsäure, Isoplacodiolsäure, Isopseudoplacodiolsäure,
Methylisoplacodiolsäure und Methylisopseudoplacodiolsäure. Weitere bei
Haematomma vorkommende Flechtenstoffe sind Sphaerophorin und
Isosphaersäure, wobei wohl erstere bisher mit Perlatolsäure, letztere
eventuell mit Divaricatsäure und Imbricarsäure verwechselt worden
war. Lichexanthon, ein Xanthon, dessen Vorkommen innerhalb der Gattung
nur von H. erythromma bekannt war, wird bei fünf weiteren Arten
gefunden (H. cinchonarum, H. fluorescens, H. leprarioides,
H. subinnatum und H. sulphureum), deren Verbreitung auf die
Neotropis begrenzt ist.
Die in den Epihymenien auftretenden Pigmente sind Haematommon, sowie
Russulon und Ivorion. Es wird gezeigt, daß das bisher in seiner
Struktur unbekannte Pigment Hpn-l mit Russulon, das aus Lecidea
russula beschrieben worden ist, identisch ist. Ivorion ist ein bisher
unbekanntes Anthrachinon, das innerhalb der Gattung nur bei
H. ivoriense vorkommt.
HPLC Profile für einige und Rf-Werte in den drei Standard
Fließmitteln A, B' und C, sowie Fleckfarben für sämtliche diagnostisch
bedeutsamen Flechtenstoffe in Haematomma werden tabellarisch
zusammengestellt und skizziert.
Zu den innerhalb der Gattung bisher bekannten drei sorediösen Arten
H. leprarioides, H. ochroleucum und H. sorediatum
werden vier weitere be- schrieben, die sich hinsichtlich der Chemie,
der Sporengröße und der Verbreitung von den oben genannten
unterscheiden. Diese sind H. americanum, H. brevisporum,
H. guyanense und H. kenyense. Sie können nicht-sorediösen
Primärarten zugeordnet werden.
Bei fast allen Arten werden Spermogonien und Spermatien gefunden,
wobei sich letztere als Bestimmungsmerkmal eignen. Bei einem Teil der
Arten sind sie länglich und sichelförmig gekrümmt (Typ I), bei einem
an- deren kurz und gerade (Typ II). Da kein weiteres, mit diesem
korrelieren— des Merkmal ausgemacht werden konnte, waren aus dieser
Beobachtung keine systematischen Konsequenzen zu ziehen.