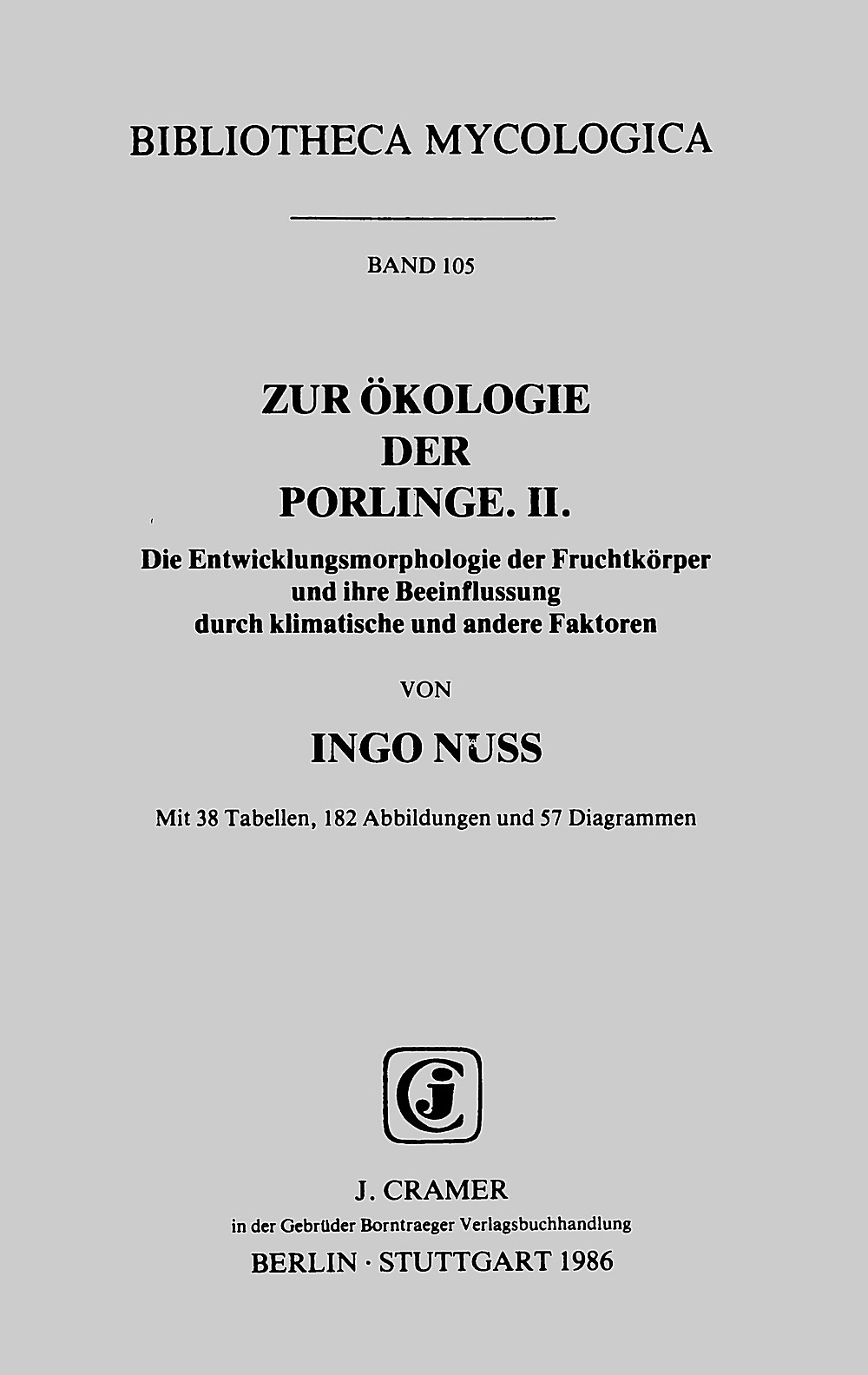Inhaltsbeschreibung top ↑
Im Freiland wurde die Entwicklungsmorphologie der Porlingsfruchtkörper
31 verschiedener Arten mit insgesamt über lOO Exemplaren zwei Jahre
lang regelmäßig untersucht. Es sollten allgemeingültige Regeln für das
Wachstum, die Sporulation sowie andere von inneren oder äußeren
Faktoren beeinflußte Vorgänge und Eigenschaften herausgefunden
werden.
Von den Arten Famitiporia (Phellinus) hippophaeicola, Ochroporus
(Phellinus) lundellii und O. nigrolimitatus, welche nur
außerhalb der Untersuchungsflächen wuchsen, wurden die jährlichen
Sporulationsphasen mit einer neu entwickelten Spo- renfalle
erfaßt. Alle übrigen Sporulationsdaten wurden mit der schon in Band I
beschriebenen Methode durch regelmäßig wöchentlich ausgetauschte
Objektträger unter den Fruchtkörpern ermittelt.
Aus den Sporulationsuntersuchungen ergibt sich die Regel, daß alle
mehrjährigen Fruchtkörper alljährlich eine mindestens viertel- bis
maximal ganzjährige Sporulationsphase haben. Einjährige Fruchtkörper
mit vergleichbarer Konsistenz haben ebenfalls eine lange
Sporulationsdauer, während einjährige, aber weichfleischige
Fruchtkörper kurzzeitige Phasen von wenigen Wochen bis zu höchstens 3
Monaten haben. Aus dem Vergleich mehrjähriger Fruchtkörper sehr
unterschiedlicher Konsistenzen zeigte sich jedoch, daß die
Sporulationsdauer nicht direkt von der Konsistenz abhängt.
Unter den Arten mit mehrjährigen Fruchtkörpern haben in der Regel
jene, de- ren Röhren offene Jahresgrenzen (limites annales pervii)
haben, eine oft erheblich längere Sporulationsphase als die
Fruchtkörper von Arten mit geschlossenenJah- resgrenzen (limites
annales impervii). Entsprechend dem Beginn der Sporulations- phasen
lassen sich die Arten den Jahreszeiten zuordnen:
Im Vorfrühling, wann Galanthus nivalis und Corylus
avellana blühen, beginnen die folgenden Arten zu sporulieren:
Trametes gibbosa, Ochroporus tuberculosus (= Phellinus pomaceus),
Gloeophyllum abietinum, Gl. odoratum, Famitopsis pinicola und
etwas später Fomes fomentarius und danach Fuscoporia
(Phellinus) cantigua, F. ferruginosa, Ochroporus lundellii und
Phylloporia ribis f euonymi, wahrscheinlich auch Fomitiporia
(Phellinus) hippophaeicola.
Im Frühling setzt die Sporulation von Fomitiporia (Phellinus)
hartigii und Skeletocutis stellae ein, die von
F. punctata, Phylloporia (Phellinus) ribis f. ribis, Ganoderma
lipsiense (= G. applanatum) und Gloeophyllum sepiarium zur
Zeit der Apfelbaumblüte (Malus domestica), und jene von
F. robusta folgt, wann der Frühling zu Ende geht und der
Frühsommer beginnt.
Im Sommer - Ende Juli, Anfang August - fangen Bandarzewia
mesenterica (= B. montana), Ganoderma carnosum (= G. atkinsonil)
und G. lucidum zu sporulieren an. Dann setzen die erste Phase
von Ischnoderma benzoinum an Abies alba sowie die Phasen
der Inonotus-Arten Inonotus hastifer (= I. polymorphus),
I. hispidus und I. nodulosus ein. I. radiatus
beginnt gegen Ende des Sommers, Anfang September, mit der Sporulation.
Schließlich folgt Ischnoderma benzoinum im Herbst mit der
zweiten Sporulationsphase.
Die Arten Ochroporus (Phellinus) alni, O. igniarius, O. tremulge,
Phellinidium (Phellinus) pouzarii, Parodaedalea (Phellinus) chrysoloma
und P. conchata haben ganzjährige Sporulationsphasen.
Großen Einfluß auf die Sporulation hat die Frostgrenze, sei es bei den
Minimum-, Durchschnitts- oder Maximumtemperaturen. Sie vermindert die
Sporulationsraten oder beendet die Sporulationsphase. Aber auch hohe
Temperaturwerte können ähnlich wirken, so bei Fomes fomentarius,
dessen Frühjahrssporulationsphase von Durchschnittstemperaturen über
+120C (bzw. +160C) beendet wird.
In ähnlicher Weise beeinflussen die Werte der relativen Luftfeuchte
die Sporulation, doch ließ sich der Einfluß kaum feststellen, weil
die Luftfeuchte während der Sporulationsphase in den
Untersuchungsgebieten nur selten extrem stark abfiel. Am Beispiel von
Fuscoporia (Phellinus) ferruginosa wird aber gezeigt, daß
Durchschnittswerte unter 80% die Sporulation beeinträchtigen, unter
60% das Aussetzen bewirken.
Die Niederschlagsmengen lösen - zumindest bei Fomitiporia
(Phellinus) punctata - nicht den Sporulationsbeginn aus,
beeinflussen aber bei Phylloporia (Phellinus) ribis f ribis
unmittelbar in derselben Woche, bei Porodaedalea (Phellinus)
Chrysoloma dagegen mit einer Woche Verzögerung die Sporenraten.
In einem Fall konnte ein biotischer Einfluß auf die Sporulation
nachgewiesen werden, als nämlich der Stamm oberhalb des Fruchtkörpers
Nr. 86 von Fomitipo- ria (Phellinus) punctata abbrach und einen
erheblichen Rückgang der Sporenmengen verursachte.
Für die Messung des wöchentlichen Fruchtkörperzuwachses wurde eine
Methode entwickelt, bei welcher ein Draht von l oder 1,6mm Durchmesser
mit einer Drahteinstech-Vorrichtung in den Fruchtkörper gestochen
wird. Der herausstehende Rest wird in seiner Länge mit einer
Uhrenschieblehre auf l/lOmm genau gemessen. Wächst der Fruchtkörper,
dann wird der Draht kürzer, und die zunehmende Differenz der
regelmäßig ermittelten Drahtlängen zum ersten gemessenen Wert gibt
exakt das Wachstum wieder.
Damit wurde erstmals das Wachstumsverhalten der mehrjährigen
Porlingsfruchtkörper während der gesamten Wachstumsphase und der
gesamten Wachstumsruhephase durch regelmäßige Untersuchungen erfaßt;
ebenso das einiger annueller Arten.
In der Untersuchung wird zwischen erkennbarem und meßbarem Wachstum
differenziert, weil Farb- und Geruchsveränderungen sowie das
Überwachsen von aufgesprühter Farbe oft schon lange Zeit vor dem
ersten meßbaren Wachstumsvorgang stattfinden und zudem eine
interessante Beziehung offenlegen: Bei allen Porlingsarten mit
geschlossenen Jahresgrenzen (limites annales impervii) beginnt das
erkennbare Wachstum vor der Sporulation, bei allen mit offenen
Jahresgrenzen (limites annales pervii) dagegen zur selben Zeit oder
später.
Das meßbare Wachstum beginnt bei fast allen untersuchten Arten
hingegen erst nach dem Sporulationsanfang, nur bei Ganoderma
lipsiense ( G. applanatum) schon vorher.
Unter den mehrjährigen Fruchtkörpern hatte im (vertikalen)
Hymenophorzuwachs G. lipsiense mit 1,7cm den größten jährlichen
Wert erreicht, gefolgt von Fomitiporia (Phellinus) robusta und
Fomes fomentarius mit je l,4cm, während Parodaedalea
(Phellinus) conchata mit sehr flachen Fruchtkörpern mit 0,19cm den
geringsten Zuwachs in dieser Richtung aufwies. Einen Spitzenwert
erreichte Inonotus hispidus mit seinen einjährigen
Fruchtkörpern und einem Zuwachs von 3,2cm in einer Woche. Danach wuchs
das Exemplar nur noch insgesamt 0,75cm.
Bei allen untersuchten mehrjährigen Arten endet das Wachstum vor,
spätestens mit der Sporulationsphase. Die Phase des meßbaren Wachstums
ist bei allen - bis auf Ganoderma lipsiense (= G. applanatum) -
kürzer als die Sporulationsphase.
Es wird die Behauptung aufgestellt, daß die Sporulation der
Fruchtkörper von Porlingsarten mit teilweise oder ausschließlich
diffusem Wachstum immer schon beginnt, bevor das Wachstum
abgeschlossen ist.
Das Wachstum der Fruchtkörper reagiert fast stets empfindlicher auf
die Umgebungstemperaturen als die Sporulation. Ein Einfluß der
relativen Feuchte oder des Regens auf das Wachstum konnte mit den hier
angewandten Methoden nicht festgestellt werden.
Biotische Faktoren, nämlich das Abbrechen von Stämmen oberhalb zweier
Un- tersuchungsfruchtkörper, verursachten dagegen deutliche
Beeinträchtigungen des Wachstums bzw. der Wachstumsraten.
Die Menge des zur Verfügung stehenden Substrates beeinflußt die
Wachstumsraten deutlich. Letztere sind jedoch nicht vom
Fruchtkörperalter, den Substratzuständen „lebend“ oder „tot“ und den
Fruchtkörpertypen „resupinat“ und „pileat“ abhängig. Mißt man am
selben Fruchtkörperexemplar verschiedene Bereiche, dann läßt sich
feststellen, daß der horizontale (in der Hauptsache also tramale
Zuwachs) relativ unabhängig ist vom vertikalen Zuwachs (in der
Hauptsache also dem der Röhren). Beide reagieren nämlich
unterschiedlich auf die Umgebungstemperaturen, das horizontale
Wachstum meßbar empfindlicher als das vertikale
Hymenophorwachstum. Überhaupt läßt sich aufgrund der verschiedenen
Messungen auf deutliche mikroklimatische Differenzen zwischen den
substratfernen und damit exponierten Fruchtkörperteilen und den
substratnahen sowie dem Hymenophorbereich schließen. Auch innerhalb
des Hymenophors wachsen die einzelnen Bereiche unterschiedlich
schnell.
Das Hymenophorfeld ist eines der wichtigsten Kriterien für die
Beurteilung des Entwicklungszustandes der Porlingsfruchtkörper. Ist es
vorhanden, befindet sich das Exemplar noch in der Wachstumsphase,
fehlt es, ist der Fruchtkörper erwachsen, also „reif“.
Während der Wachstumsphasen haben die Fruchtkörper frische, meist
hellere und leuchtendere Farben sowie oft eine anfangs lebhafte
Guttationstätigkeit. Sie strömen den arttypischen Geruch aus und sind
frei von Rissen im Hymenophor. Die Wachstumsruhephasen sind
demgegenüber durch blassere, dumpfere Farben und das häufige Fehlen
des arteigenen Geruches gekennzeichnet. Auch das Ausbleiben der
Guttation, das Fehlen eines Hymenophorfeldes und das Auftreten von
Rissen sind charakteristisch. Während der Wachstumsruhephasen trocknen
die Fruchtkörper allmählich aus und schrumpfen. Weil sie quer zum
Hyphenverlauf stärker schrumpfen als längs dazu, kommt es oft zu
Zerreißungen, welche erst vor dem Beginn der neuen Wachstumsphasen
zurückgehen.
Am Beispiel von Ganoderma lipsiense (= G. applanatum) wird
gezeigt, daß die Durchmesser der jungen diesjährigen Röhren von denen
der vorjährigen auffällig differieren können. Man könnte deshalb
annehmen, sie gehörten verschiedenen Arten an. Folglich sind Messungen
nur vergleichbar und damit sinnvoll, wenn sie an Fruchtkörpern
gleicher Entwicklungsstadien durchgeführt werden, differenziert nach
Frischmaterial und getrocknetem. Darum wird vorgeschlagen, für solche
Messungen nur reife Fruchtkörper im Sinne der von mir gegebenen
Definition zu nehmen. Von den jeweils frischen Fruchtkörpern
verschiedener Arten wurden nach diesen Kriterien die Durchmesser der
Poren und die Dissepimente quer geschnittener Röhren gemessen sowie
die Anzahl der Poren pro mm und pro mm2 bestimmt. Mit der
letztgenannten Methode lassen sich nunmehr Ganoderma carnosum (=
G. atkinsonii) und G. lucidum sowie G. lipsiense (=
G. applanatum) und G. adspersum gut unterscheiden, ebenso
die Arten Famitiporia (Phellinus) hippophaeicola, F. hartigii
und F. robusta.
Guttationstropfen werden nur während der Wachstumsphase und besonders
zu Beginn derselben bei von Art zu Art verschieden hohen
Luftfeuchtewerten gebildet. Guttationstropfen sind zugleich
Kennzeichen für die Entstehung neuer Fruchtkörperstrukturen. Bei
einigen Arten quellen sie aus Guttationskratern.
Die Farben der Fruchtkörper, besonders des Hymenophors, verändern sich
in Abhängigkeit vom Entwicklungsstadium und kennzeichnen dadurch die
jeweiligen Phasen. Der äußerste Zuwachsrand ist immer weiß oder - bei
den Hymenochaetales - weißlich hellbraun.
Durch die verschiedenen Farben der Hymenophore lassen sich die Arten
Ischnoderma benzoinum (immer bräunlich) und I. resinosum (immer
weißlich) zu jeder Zeit ihrer Entwicklung unterscheiden.
Bei den
meisten untersuchten Arten ist der Geruch an die Zeit des Wachstums
gebunden, bei einigen - Fomitiporia (Phellinus) hartigii und
Ischnoderma benzoinum z.B. — an die der Sporulation. Die beiden
Arten F. hartigii und F. robusta lassen sich im Freiland
schon anhand der sehr verschiedenen Gerüche unterscheiden, F.
hartigii riecht aromatisch süßlich, F. robusta pilzlich.
Durch fünf Merkmale wird nachgewiesen, daß sich die pileaten aus den
resupinaten Fruchtkörperformen entwickelt haben und nicht
umgekehrt. Sekundäre Reduktionsentwicklungen von pileat zu resupinat
werden als Einzelfälle nicht ausgeschlossen, müssen aber jeweils
bewiesen werden.
Anhand verschiedener Literaturstellen sowie eigener Untersuchungen
wird belegt, daß die Hutdeckschicht dem Hymenophor homolog ist. Die
Entwicklung der Hutdeckschicht wird durch äußere Einflüsse wie Licht
oder Schwerkraft eingeleitet.
Der von ULBRICH eingeführte Begriff der „geotropischen
Hymenialregeneration“ wird neu definiert. Aus den Untersuchungen wird
die Regel abgeleitet, daß die Fruchtkörper aller ganz oder teilweise
diffus wachsenden Pilzarten während der Wachstumsphase zu
geotropischer Hymenialregeneration fähig sind.
In der zuvor einzigen experimentellen Untersuchung über das Alter von
Porlingsfruchtkörpern stellten HIRT & HOPP über Ochroporus
(Phellinus) tremulae (als „Fomes igniarius“) lediglich
fest, daß die Anzahl der Röhrenschichten im Längsschnitt mit dem Alter
übereinstimme. Merkmale für die Unterscheidung der Jahreszonen (zonae
annuae) von anderen Zonen waren damit nicht gegeben.
Die Begriffe „offene“ und „geschlossene Jahresgrenzen“ (limites
annales pervii bzw. impervii) werden eingeführt. Damit ist eine klare
Differenzierung zwischen den Fruchtkörpern, deren Röhren nach dem
Jahreswechsel weiterwachsen, und jenen, deren Röhren jährlich durch
eine Tramaschicht verschlossen werden, möglich.
Für insgesamt 31 mehrjährige Porlingsarten wurde anhand sauberer
Fruchtkörperlängsschnitte festgestellt, ob sie offene oder
geschlossene Jahresgrenzen haben. Die Ergebnisse erlauben eine
einwandfreie Unterscheidung zwischen den nahe verwandten Arten
Famitiporia (Phellinus) hartigii — mit offenen - und
F. robusta - mit geschlossenen Jahresgrenzen. Sie führen auch
zu der Schlußfolgerung, daß F. hippophaeicola mit ebenfalls
offenen Jahresgrenzen (und weiteren Merkmalen) F. hartigii
näher steht als F. robusta. Ebenso sind Ganoderma
adspersum und G. lipsiense (= G. applanatum) aufgrund
dieser Eigenschaften eindeutig zu unterscheiden. Als wahrscheinlich
wird angenommen, daß Fuscoporia (Phellinus) ferruginosa in zwei
verschiedene Species aufzutrennen ist, in die eine, deren Fruchtkörper
offene, in die andere, deren Fruchtkörper geschlossene Jahresgrenzen
hat.
Nach siebenjährigen Untersuchungen werden für die folgenden Arten
Kriterien für eine Altersbestimmung der Fruchtkörper gegeben:
Fomitiporia (Phellinus) hartigii, F. punctata, F. robusta,
Fuscoporia (Phellinus) ferruginosa, Ochroporus (Phellinus) alni,
O. igniarius, O. tremulae, O. tuberculosus (= Phellinus pomaceus),
Famitopsis pinicola, Ganoderma adspersum, G. lipsiense (=
G. applanatum), Skeletocutis stellae. Für weitere Arten —
Famitiporia (Phellinus) hippophaeicola, F. texana, Fuscoporia
(Phellinus) viticola, Ochroporus (Phellinus) lundellii und Phellinus
torulosus - werden Kriterien für die als wahrscheinlich
angenommenen Jahresgrenzen angegeben.
Generell gelten die für Ochroporus (Phellinus) alni mit offenen
Jahresgrenzen (limites annales pervii) und Famitiporia (Phellinus)
robusta mit geschlossenen Jahresgrenzen (limites annales impervii)
festgestellten Merkmale der Jahresgrenzen für alle Fruchtkörper von
Porlingsarten, welche nur eine Wachstumsphase pro Jahr haben.
Das Alter der Fruchtkörper von Fomes fomentarius läßt sich auch nach
diesen Untersuchungen (wie schon nach denen von BJORNEKAER) nicht
eindeutig identifizieren.
Die Rinnen auf den Hutoberseiten der Porlingsfruchtkörper können bei
einigen Arten gute Anhaltspunkte für das Alter geben (z.B. bei
Ochroporus alni, Fomitopsis pinicola), bei anderen hingegen zu
einer völligen Fehleinschätzung führen (z.B. bei Fomitiporia
robusta und Fomes fomentarius).
Das Alter des von HARTIG in Fig. 3 abgebildeten Exemplares
(vgl. Abb. 6) wird neu bestimmt. Hatten LOHWAG es als dreijährig, JAHN
als etwa zwanzigjährig interpretiert, so wird durch die Untersuchungen
nachgewiesen, daß die Fig. 3 das Verwachsungsprodukt dreier Exemplare
darstellt, welches etwa 9 Jahre alt war.
Die Fruchtkörper der Art Trametes gibbosa werden als mehrjährig
nachgewiesen.
Als Neukombinationen werden vorgeschlagen: Fomitiporia texana
(Murrill) Nuss und Phellindium fragrans (Larsen & Lombard)
Nuss.
Es wird der Nachweis geführt, daß die geschlossenen Jahresgrenzen
(limites annales impervii) phylogenetisch ursprünglicher sind als die
offenen (limites annaler pervii).
Mit verschiedenen Methoden wird festgestellt, daß alle von mir
untersuchten Phellinus-s.l.-Arten perennierende und nicht wie der von
HIRT untersuchte Phellinus gilvus lediglich pseudoperennierende
Fruchtkörper haben.
Das Wachstum der Fruchtkörper erfolgt in mehreren Rhythmen, die
offenbar unabhängig voneinander sind und einander überlagern. Es wird
angenommen, daß allen Wachstumsvorgängen der circadiane (oder der
diurnale) Rhythmus als Grundrhythmus zugrunde liegt. Er konnte
zunächst nur bei den mehrjährigen Fruchtkörpern von Ganoderma
lipsiense (= G. applanatum) festgestellt werden. Die Rhythmen
geben sich in unterschiedlichen Zonierungen zu erkennen, und zwar den
Mikrozonen (microzonae), den Makro- (macrozonae), Saison- (zonae
temporariae) und Jahreszonen (zonae annuae), deren Merkmale
zusammengestellt wurden. Es wird festgestellt, daß sich Zonierungen
nicht nur in der Trama, sondern auch in den Röhren, der Kruste und
sogar einzelnen Hyphen beobachten lassen, daß die Röhren bei starker
Vergrößerung rhythmische Verengungen und Erweiterungen - ein Pulsieren
- zeigen und ebenso die Wände einiger Skeletthyphen. Bei Fruchtkörpern
mit offenen Jahresgrenzen ließen sich zwischen den Mikro-, Makro-,
Saison- und Jahreszonen keine qualitativen morphologischen
Unterschiede finden, hingegen besteht ein solcher bei den
Fruchtkörpern mit geschlossenen Jahresgrenzen, indem diese alljährlich
in den Röhren eine Tramaschicht als Jahreszone bilden.
Im letzten Kapitel der Arbeit werden verschiedene Gesetzmäßigkeiten
der Fruchtkörperbildung anhand der Ontogenese von Ganoderma
lucidum dargestellt. Sie werden durch Literaturbelege, eigene
Beobachtungen oder Experimente bewiesen:
1. Die Initialen gestielt-hutförmiger (stipito-pileater) Fruchtkörper
stehen senkrecht auf den sie erzeugenden Flächen.
Die Regel wird mit verschiedenen Methoden experimentell bewiesen, vor
allem mit Hilfe eines zwölfflächigen Körpers (Pentagondodekaeders),
aus dem Fruchtkörperinitialen in alle zwölf Raumrichtungen jeweils
senkrecht zu den Dodekaederflächen wuchsen.
2. Die Fruchtkörpervergrößerungen erfolgen durch ausschließlich
peripheres Wachstum.
3. Die Fruchtkörper wachsen in circadianen Rhythmen. Durch
Experimente konnte der Nachweis geführt werden, daß die Zonenbildung
der Fruchtkörper unabhängig von Außenfaktoren (endogen) und damit
circadian ist.
Während des Tages entstehen die hellen, während der Nacht die dunklen
Zonen.
4. Das Hutwachstum beschließt das Stielwachstum. Anhand der
Versuchsergebnisse wird diese Gesetzmäßigkeit indirekt bewiesen.
5. Die Exzentrizität des Hutes ist der Neigung des Stieles zur
Horizontalen proportional.
6. Bei der Hymenophorentwicklung kommt das Hyphenwachstum in den
Interstitien zum Stillstand, während es in den Dissepimenten andauert.
Dabei entstehen bei Ganoderma lucidum die Poren aus zunächst
unkoordiniert wachsenden kleinen Zähnchen oder unterschiedlich hohen
Wällen, welche im weiteren Wachsen aneinanderstoßen, die
Höhenunterschiede mehr und mehr ausgleichen und schließlich ziemlich
synchron zu Poren und Röhren auswachsen. Hieraus lassen sich
Schlußfolgerungen auf verwandtschaftliche Beziehungen ziehen. Die
Hyphendifferenzierung während der Hymenophorentstehung wird als
Ergebnis von Reifungsprozessen der führenden Hyphengruppen
interpretiert.
7. Auch die Hymenophorinitialen stehen senkrecht zu der sie
erzeugenden Fläche.
An mehreren, von der Natur vorgeführten Experimenten, speziell einem
krankhaft veränderten Ganoderma-lipsiense-(= G.-applanatum-)
Fruchtkörper, dessen Röhrenwachstum im Initialenstadium verharrte und
der anschließend Trama und erneut Initialen bildete, wird der Nachweis
für diese Gesetzmäßigkeit geführt.
8. Als unhaltbar hingegen erwiesen sich die Behauptungen EDGERTONS,
wonach das Reifen der Fruchtkörper durch äußere Faktoren bestimmt,
durch ungünstige Bedingungen ausgelöst und drittens bei allen
Fruchtkörpern desselben Stubbens synchron erfolgen würde.
Als neue Art wird vorgeschlagen: Ochroporus ossatus M. Fischer
spec.nov.