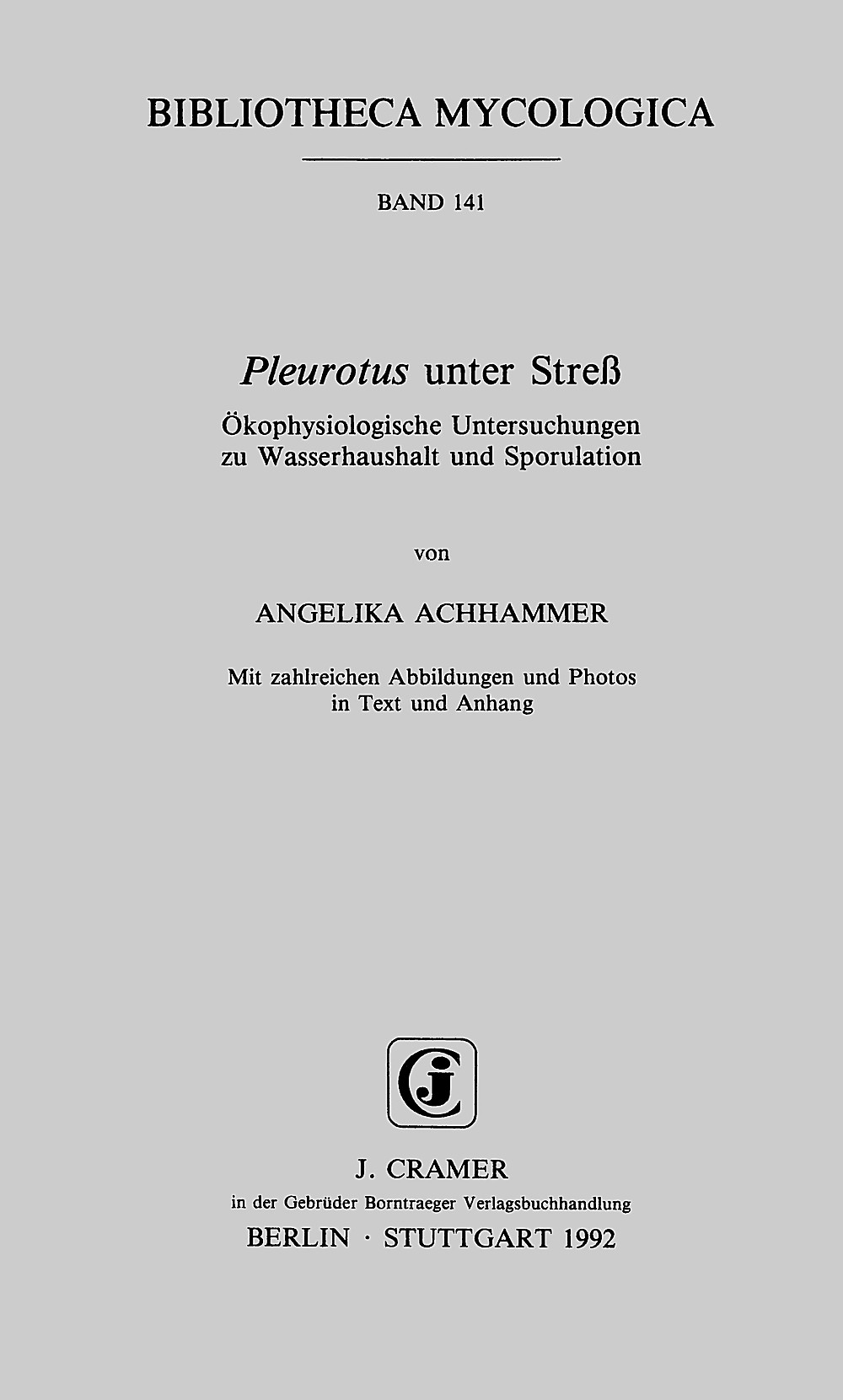Inhaltsbeschreibung Haut de page ↑
Ziel der vorliegenden ökophysiologischen Studien war, Informationen
über den Zusammenhang von Wasserhaushalt (insbesondere unter
Wasserstreßbedingungen) und Sporulation eines weichfleischig
fruktifizierenden Basidiomyceten zu gewinnen. Als Untersuchungsobjekte
wurden zwei Vertreter der Gattung Pleurotus, P. ostreatus und
P. pulmonarius, gewählt, da sie zum einen in Mitteleuropa als
"saisondimorphe" Arten heimisch sind, zum anderen — insbesondere
P. ostreatus — als aggressive Holzzersetzer, gleichzeitig aber auch
als großtechnisch kultivierte Speisepilze Praxisrelevanz aufweisen.
l. Ausgangs- und steter Anhaltspunkt der Arbeit war das
Sporulationsverhalten des (weiter verbreiteten) Winterpilzes
P. ostreatus in Korrelation mit dem Klimaverlauf am natürlichen
Standort.
Hinsichtlich einer " Langzeittendenz" (Wochen- bis Monatszeiträume)
wirken hier Temperatur- und Wasserfaktor ausschlaggebend auf die
Sporulation ein, allerdings in jahreszeitlich unterschiedlicher
Gewichtung:
- Insbesondere im Winter bei niedrigen Temperaturen bis wenig über dem
Gefrierpunkt ist die Temperatur die entscheidende Variable: Ein
Anstieg der mittleren Temperatur erhöht die Sporentagessummen
bzw. ermöglicht nach härterem Frost eine Wiederaufnahme der
Sporulation, die unter etwa -2,5°C eingestellt wird. Tage- bis
wochenlangen Frost (bis mindestens -16°C) können
P. ostreatus-Fruchtkörper unter bestimmten Voraussetzungen überstehen
und nach dem Auftauen erneut sporulieren.
— Bei durchwegs milderen Temperaturen über dem Gefrierpunkt bestimmt
dagegen der Faktor Wasser den Sporulationsverlauf: Nur regelmäßige
Niederschläge (Regen und bedingt Tau; hohe relative Luftfeuchte allein
ist hingegen unwirksam) erlauben in diesem Fall einem Fruchtkörper
eine einigermaßen kontinuierliche Sporulation. Die längste im Gelände
beobachtete Sporulationsperiode eines einzelnen Fruchtkörpers betrug
ca. vier Monate. Als Voraussetzung für solche Langlebigkeit eines
weichfleischigen Winterpilzes müssen beträchtliche Trocken- wie
Frosttoleranz angenommen werden.
Im Sporulationstagesgang ist keine endogene Rhythmik festzustellen.
Temperatur und Sporulationsintensität sind im Tagesgang nur dann
positiv korreliert, wenn Plus- und Minustemperaturen abwechseln. Bei
durchwegs milderen Temperaturen bedingt dagegen der
Temperaturanstieg untertags einen teilweise drastischen Rückgang der
relativen Luftfeuchte - verbunden mit einem steilen
Sporulationsabfall: Im Tagesgang spielt also die relative Luftfeuchte
die entscheidende Rolle.
Vor dem Hintergrund dieser Freilanddaten erfolgten unter geregelten
Laborbedingungen die weiteren Untersuchungen:
2. Zum Sporulationsverlauf von P. ostreatus- und
P. pulmonarius-Kulturfruchtkörpern in Abhängigkeit von einzelnen wie
kombinierten Klimafaktoren
- Verschiedene Klimareize (Temperatur-‚ Feuchte- und
Licht/Dunkel-Wechsel) - einzeln oder in Kombination - wurden von
beiden Pleurotus-Arten in grundsätzlich gleicher Weise beantwortet.
— Entsprechend den Hinweisen aus den Geländedaten, läßt sich endogene
(z.B. circa-diane) Rhythmik mit Sicherheit ausschließen.
- Während sich die grundsätzliche Bedeutung ausreichender relativer
Luftfeuchte für die Sporulationsdauer eines Fruchtkörpers bestätigte,
zeigte im Laborexperiment ein Feuchtewechsel - völlig im Gegensatz zu
den Freilandbefunden - keine eindeutige Wirkung auf die
Sporulationsintensität.
— Die Temperatur dagegen ist in nicht extremen Bereichen (zwischen 8
und 22°C) eindeutig positiv mit der Sporulationsintensität korreliert;
ein T-Anstieg wird dabei typischerweise mit einer "überschießenden"
("phasischen") Reaktion beantwortet.
— Überraschenderweise stellte sich (im Labor!) das Licht als
regelrechter "Sporulationskiller" heraus: Sehr häufig war der
Sporulationsverlauf bei Licht/Dunkel-Wechsel als
"Alles-oder-Nichts-Reaktion" zu charakterisieren.
3. Untersuchungen zum Schwerpunkt 'Wasserfaktor'
3.1. Zu den Wasserverhältnissen im Fruchtkörper allgemein
Eine im wesentlichen gravimetrische Erfassung des Wasserabgabe-‚
Wasseraufnahme- und Wasserleitungsverhaltens verdeutlichte
eindrücklich den Poikilohydren-Status von
Pleurotus. Transpirationsschutz im Sinne Höherer Pflanzen existiert
nicht: So klassifizierten exakte Wasserpermeabilitätsmessungen die
Hutdeckschicht von Pleurotus (und einer Reihe weiterer Basidiomyceten)
als ebenso " effektive" Wasser"barriere" wie Schreibpapier. Insofern
läßt sich streng genommen von Was- ser"haushalt" schwerlich sprechen:
Die bestimmenden Phänomene sind rein physikalischer Natur (etwa
Evaporation, Quellung und Diffusion).
- Entsprechend der Evaporation eines gleichgestalteten
wasserdurchtränkten physikalischen Körpers ist demnach die eines
Pleurotus-Sporokarps (neben ihrer Abhängigkeit von klimatischen
Variablen) umso intensiver, je größer sein Oberflächen/Volumen-
Verhältnis ist. Daher setzt büschelförmiges (verglichen mit solitärem)
Wachstum als "passiver" Verdunstungsschutz die
Evaporationsgeschwindigkeit der Pleurotus-Fruchtkörper ganz erheblich
herab; bei gravierenderer Austrocknung "halten" speziell die Lamellen
durch Wellung und Schrägstellung Restwasser verhältnismäßig lang fest.
— Was die Wasseraufnahme und -weiterleitung betrifft, gelten auch hier
vorwiegend physikalische Gesetze: So kann über die relativ
großflächige Hutdeckschicht verfügbares Wasser wesentlich
effizienter absorbiert werden als über den Stielquerschnitt. Den
räumlich-zeitlichen Verlauf der Wasserweiterleitung im Sporokarp
bestimmen - abgesehen von den Klimavariablen - hauptsächlich dessen
Morphologie und vor allem Anatomie (Hyphentextur!).
- Von Interesse ist der Fruchtkörper-Wasserhaushalt insbesondere im
Zusammenhang mit dem Phänomen des sogenannten “Wiederauflebens”
allgemein. Während evaporierende Pleurotus-Fruchtkörper gelegentlich
erst unterhalb eines Restwassergehalts von 26% des Trockengewichts die
Sporulation einstellten, sind für eine Sporulationswiederaufnahme
i.d.R. mindestens 300% des Trockengewichts erforderlich. Da ein
ausgetrockneter Fruchtkörper durch ausschließliche Aufnahme von
Wasserdampf maximal nur etwa 45% seiner Trockenmasse an Wasser zu
absorbieren vermag, ist die Verfügbarkeit von tropfbar flüssigem
Wasser Voraussetzung für ein "revival", welches im Schnitt bereits 4—5
Stunden später erfolgen kann.
3.2. Zur Auswirkung von Wasserdefizit (Trocken-‚ Frost- und Osmostreß)
auf Zustand und Funktion eines Fruchtkörpers
Taupunktpsychrometrie erwies sich zur Bestimmung des Wasser— und des
osmotischen Potentials verschiedener Teile frischer oder nach
Trocknis wiederaufgequollener P. Ostreatus-Fruchtkörper als
prinzipiell problematisch. Eindeutig allerdings errechneten sich für
das Hymenophor gequollener Sporokarpe "grundsätzlich positive,
teilweise recht hohe (Mindest-)Turgorpotentiale‚ was wohl als Hinweis
für die Vitalität zumindest eines Teils der Basidien — und damit
indirekt für Trockentoleranz - gewertet werden darf.
Die rasterelektronenmikroskopische Untersuchung frischer, (monatelang)
lufttrockkener sowie wiederaufgequollener
P. Ostreatus-Fruchtkörper, die teilweise Frost
unterschiedlicher Dauer und Intensität ausgesetzt wurden,
demonstrierte wiederum erstaunliche Trocken- und zusätzlich
Frosttoleranzeigenschaften der Sporokarpe. Selbst die "härteste"-
Frostbehandlung (28 h -20°C) wurde von einem Teil der sterilen Hyphen
resp. Hymenialelemente immer überlebt: So wirkten etwa - insbesondere
im frischen Fruchtkörper - die vollplasmatischen jüngeren Basidien
i.d.R. wenig beeinträchtigt; damit wäre beispielsweise bei
winterlichen Wärmeeinbrüchen eine rasche Sporulationswiederaufnahme
möglich.
In Vitalitätstests mittels Fluoresceindiacetat zeigten künstlich
eingefrorene Proben von P. ostreatus-Kulturfruchtkörpern eine
zwar eindeutige, aber nur mäßig intensive "Vitalfluoreszenz". Ein
während Dauerfrost direkt nach Entnahme vom Standort präpariertes
Freiland-Sporokarp hingegen bestand in sämtlichen Teilen weitestgehend
aus lebenden Hyphen bzw. Hymenialelementen und bewies damit seine
"Eignung" als "Winterpilz".
Osmostreß wurden alle Stadien des Lebenszyklus von Pleurotus
ausgesetzt:
Kochsalz und Glycerol in sich entsprechenden Osmolalitäten
beeinflußten hierbei das Wachstum des vegetativen Mycels in
vergleichbarer Weise; P. ostreatus und P. pulmonarius
zeigten keine signifikanten Toleranzunterschiede.
Optimal (höchste Geschwindigkeit und Gesamtproduktion) verlief das
vegetative Wachstum bei umgerechnet etwa -O.9 MPa
Substratwasserpotential; eingestellt wurde es zwischen -4,1 und -4,6
MPa. Als wasserstreßsensitivstes Lebensstadium war Fruchtkörperbildung
von P. ostreatus bis S—l,8 MPa Substratwasserpotential möglich. Sporenkeimung, nicht aber die Ausbildung intakter Keimmycelien,
wurde bei P. ostreatus noch bei -5,l MPa beobachtet; Dikaryen
installierten sich bis ca. -2,7 MPa.
In summa zeigte Pleurotus also recht beeindruckende
Osmotoleranz, die sich aber - bezüglich aller Lebensstadien - doch
weitgehend innerhalb der "Norm" terrestrischer lignicoler
Basidiomyceten bewegt.
Abschließend wurden Fruchtkörper verschiedener P. ostreatus-
und P. pulmonarius- Stämme, die teilweise auf
Kochsalz-angereicherten Medien und/oder unter Kälte- bis
Frosteinwirkung gezogen worden waren, hinsichtlich ihres Gehalts an
löslichen Koh- lenhydraten untersucht.
Der Gesamtanteil der
gaschromatographisch identifizierten Polyole plus Trehalose belief
sich auf durchschnittlich etwa 78% der isolierten "Neutralfraktion" =
neutrale Kohlenhydrate ohne reduzierende Zucker; bis zu 28% der
Trockenmasse!) und zeigte - innerhalb desselben Stammes - keine
wesentliche Abhängigkeit von der Vorbehandlung der
Kulturen. Gewichtsprozentig vorherrschend waren Trehalose und
Mannitol: "Konstitutiv" (ohne Wasserhaushaltsbelastung) stellte dabei
die Trehalose mit durchschnittlich 66% den weitaus größten Teil der
Neutralfraktion (NF); unter intensiverer Kälteeinwirkung betrug sie
sogar bis zu 77% NF . Bei zunehmender NaCl-Belastung des
Kultursubstrats ging sie jedoch dramatisch zurück (minimal 16% NF) -
und zwar zugunsten des Mannitols, welches von konstitutiv
durchschnittlich etwa 8% bis auf maximal 62% NF anstieg. Der
offensichtliche Abbau des Disaccharids Trehalose in je zwei Moleküle
Mannitol darf wohl als osmoregulatorische Antwort auf mäßige bis
stärkere Salzbelastung gewertet werden, während der ansonsten
dominierenden Trehalose eine Rolle als Membranprotectans, insbesondere
bei Frosteinwirkung, zukommen könnte.