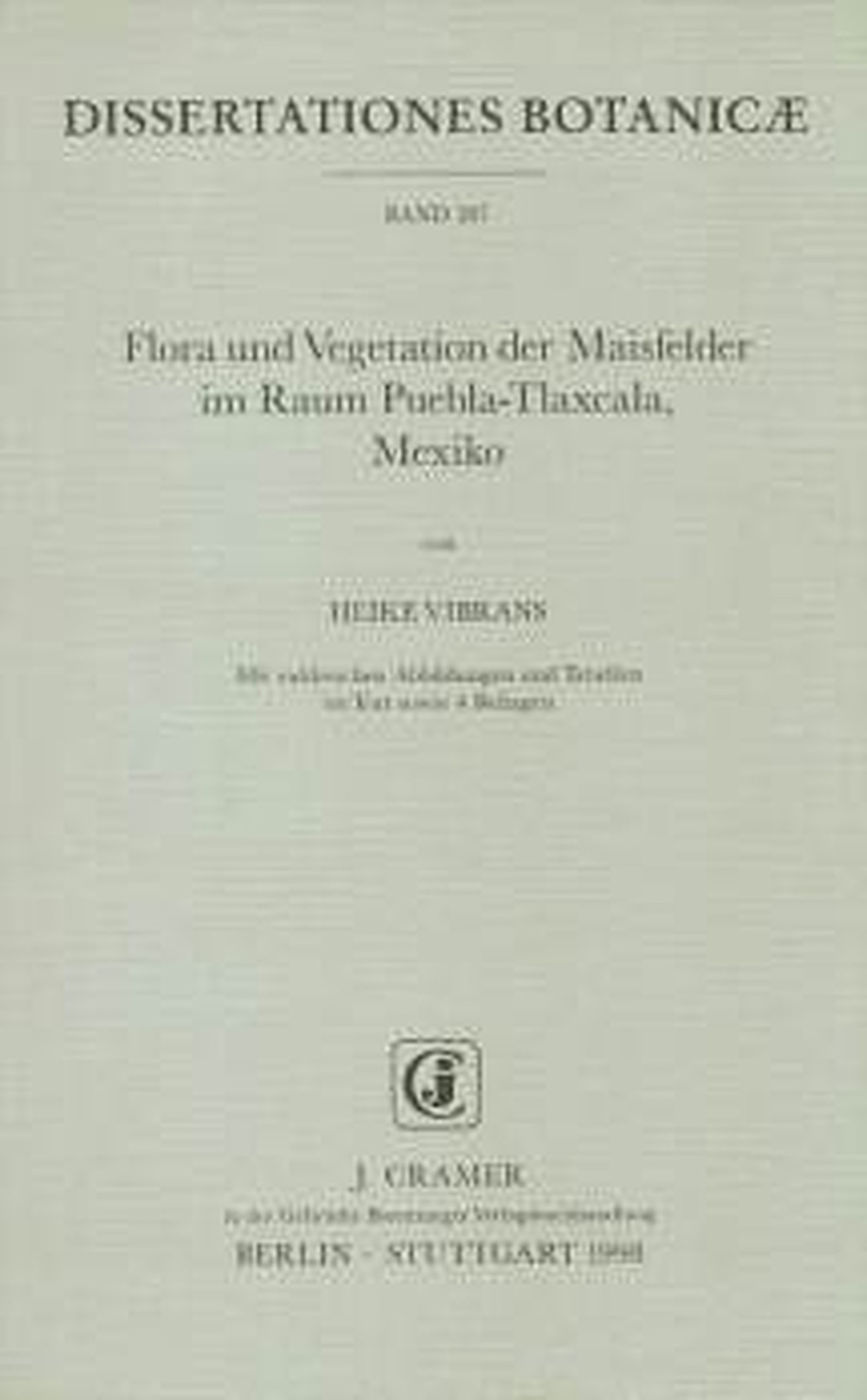Bespr.: Tuexenia 20 (2000), S. 445
top ↑
Während Maisfelder bei uns in Europa eher zu den neuartigen
Intensivkulturen gehören, sind sie in Mexico altes Kulturerbe. Dies
könnte schon besonderes Interesse an vorliegender Arbeit (110 DM)
wecken. Zudem fehlen aus Mittelamerika pflanzensoziologische Arbeiten
fast ganz und sind, wenn vorhanden, kaum solchen anthropogenen
Vegetationstypen gewidmet. Dies zeigt auch die anfängliche
Literaturübersicht der Autorin selbst. Die Arbeit basiert auf
Braun-Blanquet-Vegetationsaufnahmen von 378 Maisfeldern und ca. 90
anderer Kulturen in einem Hochhecken (über 2000 m NN)
Zentral-Mexicos. Hier ist schon erster Ackerbau vor etwa 8000 Jahren
nachgewiesen. Zunächst (nach allgemeineren Einführungen) wird der
Ackerbegleitflora nach systematischen und chorologischen Kriterien
nachgegangen. Es gibt sowohl echte Endemiten wie auch viele Neophyten
aus der Alten Welt. Interessant ist die Beziehung von Artvorkommen und
ökologischen Bedingungen. Für 98 Arten werden Mittelwerte für einige
Parameter gegeben, vermutlich eine bisher einmalige Liste in diesem
Lande. Die pflanzensoziologische Analyse geschieht gewissermaßen im
(noch) luftleeren Raum, eine echte Pionierarbeit! Erfreulicherweise
bleibt die nomenklatorisch-syntaxonomische Einstufung vorsichtig. So
gibt es eine "Ordnung von Bidens odorata" innerhalb der Chenopodietea
mit 2 Verbänden und 7 Assoziationen mit weiterer Untergliederung. Auch
hier zeigt sich wiederum, daß die Braun-Blanquet-Methode weltweit gut
anwendbar ist. Die zugehörigen Vegetationstabellen weisen eine aus
europäischer Sicht merkwürdige Mischung altvertrauter und unbekannter
Pflanzennamen auf. So dürfte die Arbeit auch für mitteleuropäische
Geobotaniker von Interesse sein.
H. Dierschke
Tuexenia 20 (2000), S. 442
Inhaltsverzeichnis
top ↑
1. Einleitung 1
1.1. Mexiko als Entwicklungszentrum von Kultur, Landwirtschaft und Flora 1
1.2. Mexiko als Entwicklungszentrum für Unkräuter 1
1.3. Stand der Kenntnisse zu der Ackerwildkraulflora und -vegetation 3
1.4. Zielsetzung 4
1.5. Auswahl des Untersuchungsgebietes 5
1.6. Einige Bemerkungen zur Terminologie 6
2. Literaturübersicht 7
2.1. Arbeiten über die Landwirtschaft im Untersuchungsgebiet 7
2.2. Literatur über die Primärvegetation im Untersuchungsgebiet 8
2.3. Grundlegende Literatur zum Thema Unkräuter 8
2.4. Bestimmungsliteratur 9
2.5. Literatur zum Thema Unkräuter auf dem amerikanischen Kontinent 9
2.6. Floristische und synökologische Arbeiten zu Ackerwildkräutern in Mexiko 10
2.7. Arbeiten zur Autökologie und zum Konkurrenzverhalten von Ackerwildkrautarten 12
2.8. Nutzung der Ackerwildkrautarten 13
3. Methoden 14
3.1. Feldarbeit 14
3.1.1. Übersicht über die Aufnahmen 14
3.1.2. Aufnahmemethode 14
3.2. Auswertung der Daten 15
3.2.1. Pflanzenbestimmung 15
3.2.2. Daten aus Landkarten 16
3.2.3. Bearbeitung der Bodenproben 17
3.2.4. Datenverarbeitung 18
3.2.4.1. Erstellung der Vegetationstabellen 18
3.2.4.2. Andere Datenbearbeitungen 22
4. Einführung in das Untersuchungsgebiet 24
4.1. Abgrenzung 24
4.2. Wichtige geographische Strukturen 25
4.3. Naturräumliche Einheiten 25
4.4. Geologischer Untergrund 26
4.5. Böden und Erosion 26
4.6. Das Klima 28
4.6.1. Niederschlag 28
4.6.2. Temperatur 28
4.7. Natürliche Vegetation 29
4.8. Die Bevölkerung 31
4.9. Die Landwirtschaft 32
4.10. Streiflicht auf die Nutzung der Ackerwildkräuter 35
5. Die Begleitflora der Maisfelder 37
5.1. Die systematische Zusammensetzung 37
5.1.1. Die Arten 37
5.1.2. Die Gattungen 39
5.1.3. Die Familien 40
5.1.3.1. Resultate 40
5.1.3.2. Vergleich und Diskussion 43
5.1.3.3. Gründe für die Dominanz der Asteraceae 44
5.2. Die photogeographische Zusammensetzung der Flora 48
5.2.1. Das Arealtypenspektrum 48
5.2.2. Endemiten Mexikos (Verbreitungstyp 1) 51
5.2.3. Endemiten der Region: südwestliche USA bis Mexiko (Typ 2) 51
5.2.4. Endemiten der Region: Mexiko bis Zentralamerika (Typ 3) 52
5.2.5. Endemiten der Region: südwestliche USA bis Zentralamerika (Typ 4) 52
5.2.6. Weitverbreitete Arten: südliche USA oder Mexiko bis Südamerika (Typen 5 und 6) 53
5.2.7. Weitverbreitete Arten: Amerika (Typ 7) 53
5.2.8. Arten mit sonstigen Arealen (Typ 8) 54
5.2.9. Neophyten (Typ 9) 54
5.2.10. Vergleich und Diskussion 55
5.3. Die Einwanderung von Ackerwildkräutern aus der Alten Welt - zum Neophytenproblem 57
5.3.1. Einleitung 57
5.3.2. Was ist ein Neophyt? 57
5.3.3. Anteil an der Gesamtflora und -vegetation 61
5.3.4. Die geographische Herkunft 61
5.3.5. Die systematische Zusammensetzung 63
5.3.6. Die ökologische Zusammensetzung 64
5.3.6.1. Zur ökologischen Herkunft der altweltlichen Arten 64
5.3.6.2. Ökologische Schwerpunktbildung im Untersuchungsgebiet 67
5.4. Diskussion 68
6. Räumliche Verbreitung und ökologische Präferenzen der häufigen Arten 72
6.1. Verbreitung der Arten im Untersuchungsgebiet 72
6.1.1. Arten mit einer allgemeinen Verbreitung 72
6.1.2. Arten mit der Hauptverbreitung im nördlichen 2/3 des Untersuchungsgebietes 74
6.1.2.1. Arten die mehr als 40 mal im ganzen nördlichen Bereich vorkommen 74
6.1.2.2. Arten, die bis zu 30 mal im ganzen nördlichen Bereich vorkommen 75
6.1.2.3. Arten, die nur in Höhenlagen über 2500 m vorkommen 75
6.1.2.4. Arten, die den Verbreitungsschwerpunkt in Höhenlagen haben, aber in
Bewässerungsfeldern hinabsteigen 76
6.1.2.5. Arten, die nur im nordwestlichen Teil des Untersuchungsgebietes vorkommen 77
6.1.2.6. Arten, die hauptsächlich in den zentralen Tälern vorkommen (zwischen Apizaco, Texmelucan, Atlixco, Puebla und Acatzingo), oft mit Bewässerung assoziiert 77
6.1.2.7. Arten, die hauptsächlich im Tal zwischen Texmelucan und Atlixco vorkommen 79
6.1.3. Arten, die hauptsächlich in der südlichen Hälfte des
Untersuchungsgebietes vorkommen 80
6.1.3.1. Arten, die hauptsächlich auf basischen Böden vorkommen 80
6.1.3.2. Arten mit einem Verbreitungsschwerpunkt im Süden, aber zerstreuten Vorkommen im Norden 81
6.1.3.3. Arten die wahrscheinlich thermophil sind 81
6.1.3.4. Arten, die nur südlich der Linie Puebla-Tepeaca vorkommen 83
6.1.4. Arten mit Verbreitungsmustern, die in keine der oben genannten Kategorien paßt 83
6.2. Artvorkommen und Umweltbedingungen 84
6.2.1. Einleitung 84
6.2.2. Relative Bedeutung diverser Umweltfaktoren für die Verbreitung der Arten 84
6.2.3. Die Umweltfaktoren und ihr Einfluß auf die Verbreitung der Sippen 89
6.2.3.1. Höhenlage 89
6.2.3.2. Boden: pH-Wert 90
6.2.3.3. Boden: Leitfähigkeit 90
6.2.3.4. Boden: Textur 91
6.2.3.5. Klima: Temperaturstufen 91
6.2.3.6. Klima: Niederschlag 91
6.2.3.7. Klima: Zahl der feuchten Monate 92
6.2.3.8. Klima: Wasserstatus 92
6.2.3.9. Deckung des Maises (Beschattung) 92
6.2.3.10. Deckung der Unkräuter insgesamt (Konkurrenz) 92
6.2.3.11. Zahl der Arten in der Aufnahme (Diversität) 93
6.3. Diskussion und Schlußfolgerungen 93
7. Die Pflanzengesellschaften der Maisfelder 94
7.1. Einleitung 94
7.2. Syntaxonomische Einteilung 95
7.2.1. Vorbemerkungen 95
7.2.2. Zuordnung zu Klasse und Ordnung 96
7.2.3. Zuordnung der Gesellschaflen der Bewässerungsfelder 97
7.3. Übersicht 97
7.4. Beschreibung der Gesellschaften 99
Gesellschaft 1: Verband von Nama dichotomum und Simsia amplexicaulis (Namio-SimSion) 99
Gesellschaft 1.1.: Assoziation von SaLazia humilis (Sabazietum humilis) 99
Gesellschaft 1.1.1. Differentialartenarme Höhenform (Veg.tab. 1) 100
Gesellschaft 1.1.1.1.: Differentialartenarme Ausbildung (Veg.tab. 1) 101
Gesellschaft 1.1.1.2.: Achillea millefolium-Ausbildung (Veg.tab. 1) 101
Gesellschaft 1.1.2. Subassoziation von Drymaria malachioides (Sabazietum drymarietosum malachioidis) (Veg.tab. 2 und 3) 101
Gesellschaft 1.1.3.: Subassoziation von Scleranthus annuus (Veg.tab. 4) 103
Gesellschaft 1.2.: Zentral-Assoziation von Simsia amplexicaulis und
Lopezia racemosa (Simsio-Lopezietum) (Veg.tab. 5-13) 104
Gesellschaft 1.2.1.: Subassoziation von Drymaria div.sp. (Veg.tab. 5) 105
Gesellschaft 1.2.1./f: Acalypha indica-Ausbildung der bewässerten
Felder (Veg.tab. 5) 106
Gesellschaft 1.2.2.: Subassoziation von Lepidium virginicam (Veg.tab.6) 106
Gesellschaft 1.2.3.: Zentrale Subassoziation (Simsio-Lopezietum
typicum) (Veg.tab.7-12) 107
Gesellschaft 1.2.3.1.: Variante mit Lopezia racemosa und Tinantia erecta (Veg.tab. 7) 107
Gesellschaften 1.2.3.1./f: Die feuchten Ausbildungen (Veg.tab. 8-9) 108
Gesellschaft 1.2.3.1./fl: Feuchte Acalypha indica-Ausbildung (Veg.tab. 8) 109
Gesellschaft 1.2.3.1./f2: Feuchte Ausbildung mit Galinsoga
quadriradiata und Melumpodium perfoliatum (Veg.tab. 9) 109
Gesellschaft 1.2.3.1./f: Feuchte Ausbildung mit Melilotus indicas
(Veg.tab.9) 109
Gesellschaft 1.2.3.2.: Zentrale Variante des Simsio-Lopezietumtypicum (Veg.tab. 10) 110
Gesellschaft 1.2.3.2./f: Feuchte Ausbildung mit Acalypha indica (Veg.tab. 10) 111 Abb.
Gesellschaft 1.2.3.3.: Artenarme Variante (Veg.tab. 11) 111
Gesellschaft 1.2.3.3./f Feuchte Ausbildung mit Melilotus indicus (Veg.tab. 12) 112
Gesellschaft 1.2.4.: Subassoziationvonlpomoeastans (Veg.tab. 13) 113
Gesellschaft 1.3.: Die Assozation von Bidensferalifolia (Veg.tab. 14).114
Gesellschaft 1.4.: Die Richardia scabra-Gesellschaft (Veg.tab. 15) 114
Gesellschaft 1.5.: Assoziation von Dyssodia papposa (Veg.tab. 16) 115
Gesellschaft 1.5./f Feuchte Variante mit Acalyphaindica (Veg.tab. 16)116
Gesellschaft 2. Verband von Sanvitalia procambens 116
Gesellschaft 2.1.: Die Zentralassoziation (Veg.tab. 17) 117
Gesellschaft 2.2.: Assoziation von Simsia lagascneformis (Veg.tab. 18-19) 118
Gesellschaft 2.2.1.: Zentrale Subassoziation von Simsia Abb. Iagascneformis (Veg.tab. 18) 118
Gesellschaft 2.2.1./f Feuchte Chenopodium murale-Ausbildung (Veg.tab. 19) 118
Gesellschaft 2.2.2.: Subassoziation von Salvia tehaucona und Melumpodium longipilum (Veg.tab. 19) 118
7.5. Schlußbetrachtung 119
7.5.1. Vegetation und Höhenstufe 119
7.5.2. Vegetation und Boden 120
7.5.3. Vegetation und Feuchtigkeit 121
7.5.4. Verbreitung der Ackerwildkraut-Gesellschaften und die
Formationen der natürlichen Vegetation 122
7.5.5. Vergleich mit anderen Gebieten 122
7.5.6. Ausblick 123
Zusammenfassung 124
Summary 126
Resumen 128
Literaturverzeichnis 130
Anhang 141 (mit Abkürzungsschlüssel für die Vegetationstabellen)