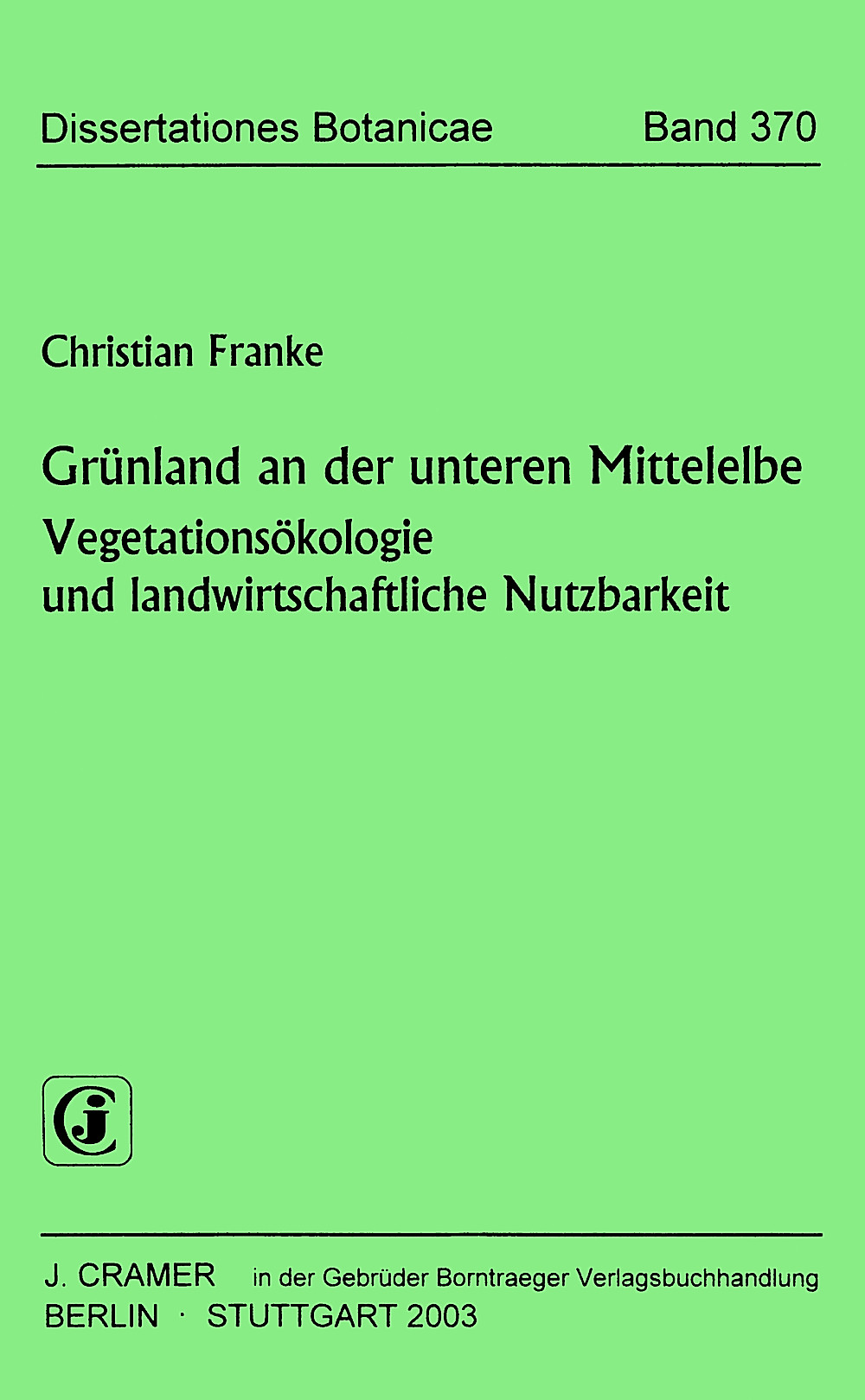Die in dieser Arbeit vorgestellten Untersuchungen im Grünland des niedersächsischen Elbtals wurden im Rahmen eines interdisziplinär angelegten Forschungsvorhabens unternommen. Ziel dieser Arbeit war zum einen die ökologische Charakterisierung der vorgefundenen Pflanzenbestände im Bereich aktuell landwirtschaftlich genutzten Grünlandes. Zum anderen sollten für eine erfolgreiche Umsetzung von Naturschutzzielen mit der Landwirtschaft Planungs-Grundlagen geschaffen und Wege gezeigt werden, wie Aufwüchse von Naturschutzflächen in landwirtschaftlichen Betrieben verwertet werden können. Die hier gezeigten Ansätze sollen eine Synthese der Bewertung von Grünland aus naturschutzfachlicher und aus landwirtschaftlicher Sicht ermöglichen.
Floodplain grassland is in the focus of both, nature conservationists and farmers. Naturally, they have differing interests regarding its management. This thesis aims at bringing different viewpoints together. For this purpose, at the River Elbe, in Lower Saxony (Germany), a wide range of grassland-types occuring in the floodplain was analysed. Abiotic parameters of soil and flooding conditions and also ways of management were analysed and tested for correlation with vegetation structure to characterise the ecological situation. This value of the biota was assessed by means of phytosociological relevés, which were related to established conservation value in the literature. Also, yield and forage value of phytomass were recorded, to define the agricultural value of the grasslands. As a result, a significant correlation between species composition and forage value was found. This made it possible, to give a parameter-based synopsis for the utilisation of the herbage of the different grassland types under several management conditions are shown.
Bespr.: Kieler Notizen zur Pflanzenkunde in Schleswig-Holstein und Hamburg, 33/2
Haut de page ↑
Die Dissertation von Chr. Franke gibt einen detaillierten Überblick über Pflanzengesellschaften, Standortverhältnisse, Phytomasseproduktion und Futterqualität der Grünlandbestände an der unteren Mittelelbe. Zwischen 1998 und 2000 wurden auf 69 Probeflächen Untersuchungen zu den genannten Parametern durchgeführt, um die ökologischen Bedingungen und die landwirtschaftlichen Eigenschaften des Grünlands zu charakterisieren. Die wesentlichen Ergebnisse: Die Grünlandvegetation der Elbtalaue wird vor allem durch die hydrologischen Bedingungen (Anzahl Überflutungstage) und das Nutzungsregime beeinflusst, während die Bodeneigenschaften eine untergeordnete Rolle spielen. Besonders artenreiche Stromtalwiesen haben sich unter 2-schüriger Mahd entwickelt. Sowohl Trockenmasseproduktion als auch Futterqualität variieren stark zwischen den untersuchten 12 Pflanzengesellschaften, so dass sich in der Vegetationszusammensetzung letztlich auch das landwirtschaftliche Verwertungspotenzial widerspiegelt. Insgesamt ist das Werk ein (positives) Beispiel für die gute alte (deutsche) Doktorarbeit: Eine Vielzahl von Einzelergebnissen, die für den grünlandinteressierten Leser und Datensammler von großer Bedeutung sein können. Allerdings wartet der (angloamerikanisch) geprägte Vegetationsökologe vergeblich auf die konkreten, zu überprüfenden Hypothesen oder manipulative Experimente zur Analyse bestimmter Prozesse oder Mechanismen. Man kann nicht alles haben und muss sich manchmal entscheiden: Ich bin froh, dass ich mich als "grassland ecologist" auch für das Lesen und die Besprechung dieser Dissertation entschieden habe, denn nun habe ich das Werk in meinem Bücherregal stehen und kann bei Bedarf auf die dort dargestellten Ergebnisse und Zusammenhänge zurück greifen!
Kai Jensen
Abbildungsverzeichnis 3
Tabellenverzeichnis 5
Definitionen und Abkürzungen 7
1 Einleitung 10
2 Material und Methoden 13
2.1 Untersuchungsgebiet 13
2.2 Untersuchte landwirtschaftliche Betriebe 19
2.3 Witterungsverlauf im Untersuchungszeitraum 21
2.4 Probeflächenauswahl 21
2.5 Bodenanalysen 23
2.6 Berechnung der Uberflutungshäufigkeit 23
2.7 Erhebung von Bewirtschaftungsdaten 24
2.8 Vegetationsaufnahmen und synsystematische Einordnung 26
2.9 Untersuchung der oberirdischen Phytomasse 27
2.9.1 Ermittlung von Trockensubstanzerträgen 28
2.9.2 Analyse von Inhaltsstoffen in der Phytomasse 28
2.9.3 Bestimmung der Futterqualität 30
2.9.3.1 Aktuelle Futterqualität 30
2.9.3.2 Potentielle Futterqualität 30
2.10 Verwertungspotenziale für die Phytomasse 31
2.11 EingesetztestatistischeVerfahren 31
3 Ergebnisse 33
3.1 Vegetation 33
3.1.1 synsystematische Einordnung 33
3.1.2 Artenreichtum und Evenness 39
3.1.3 Einfluss von Bodeneigenschaften 41
3.1.4 Einfluss der Uberflutungshäufigkeit 45
3.1.5 Einfluss der Nutzungweise 50
3.1.6 Vegetation und Einflussfaktoren in der Zusammenschau 54
3.2 Trockensubstanzerträge 58
3.3 Inhaltsstoffe in der Phytomasse 60
3.3.1 Stickstoff- und Rohproteingehalte 61
3.3.2 Rohfasergehalte 65
3.3.3 Rohaschegehalte 67
3.3.4 Phosphor- und Kaliumgehalte und -entzüge 70
3.4 Futterqualität 74
3.4.1 Netto-Energiegehalte 74
3.4.2 Potentielle Futterqualität 79
3.5 Qualität der Phytomasse in Abhängigkeit von Nutzungszeitpunkt
und Artenzusammensetzung 84
3.5.1 Regressionsanalysen anhand des Nutzungszeitpunktes 84
3.5.2 Einfluss der Artenzusammensetzung auf die Qualität
der Phytomasse 88
3.5.3 Schnittverzögerung im zweiten Aufwuchs 91
3.6 Energieerträge 91
3.7 Verwertungspotenziale durch Tiere 93
4 Diskussion 102
4.1 Vegetationsökologische Besonderheiten von Grünland in der
Elbtalaue 1 02
4.2 Was bestimmt die Futterqualität- der Nutzungstermin oder die
Artenzusammensetzung? 1 09
4.3 Verwertungspotenziale für die Phytomasse von
Grünlandgesellschaften des Elbtals 1 16
4.3.1 Verwertungspotenziale durch Tiere 116
4.3.2 Weitere VerwertungsmöOlichkeiten 122
4.4 Naturschutzfachliche und landwirtschaftliche Bewertung von
Grünlandbeständen: Ist eine Synthese möglich? 125
5 Zusammenfassung 139
6 Summary 143
7 Literatur 144