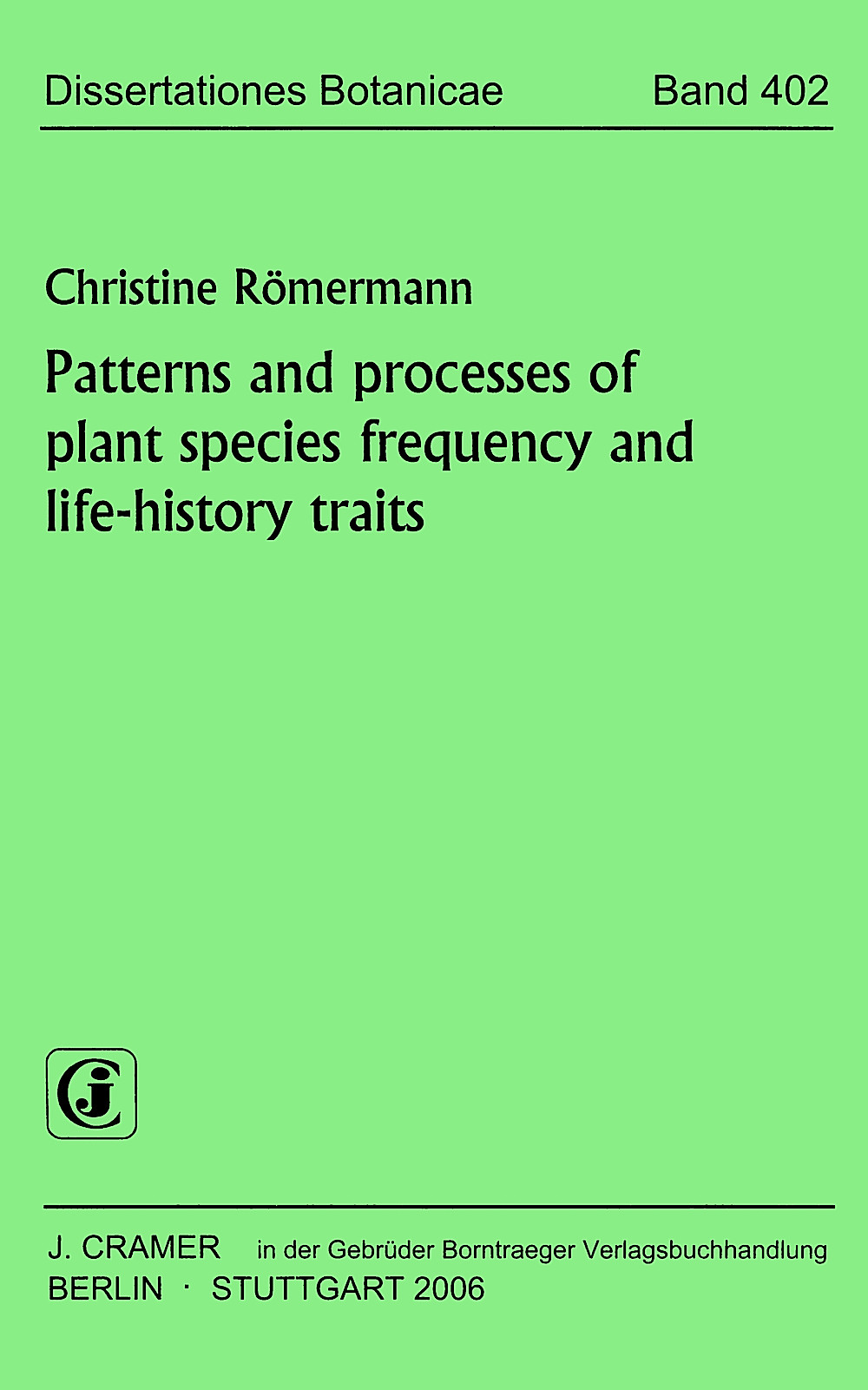Die Analyse der Ursachen für die Seltenheit bzw. Gefährdung von Arten ist eine
der wichtigsten Fragestellungen der naturschutzorientierten Forschung. Die
vorliegenden Forschungsergebnisse dienen häufig als Leitfaden bei der
Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen. Untersuchungsgegenstand der modernen
Ökosystemforschung ist unter anderem die Einbeziehung funktioneller
Artmerkmale, um Beziehungsgefüge und Veränderungen in Lebensgemeinschaften
zu interpretieren. In der vorliegenden Dissertation verbindet Christine
Römermann diese beiden Forschungsansätze, zeigt die Möglichkeiten bei der
Verknüpfung bestehender Datenbanken (z.B. FlorKart, LEDA) auf und wertet
diese Daten auf großräumiger Ebene aus (Bundesländer, Deutschland).
Die in der Arbeit enthaltenen Kapitel und Unterkapitel sind jeweils im Stil
von Einzelpublikationen aufgebaut. Die Mehrzahl dieser sind bereits in
abgewandelter Form, komplett oder auszugsweise, in unterschiedlichen
wissenschaftlichen Zeitschriften oder als Buchbeiträge erschienen oder
eingereicht.
Die Autorin beginnt zunächst mit einer allgemeinen Einführung in die Thematik.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Seltenheit von Arten und deren Habitaten.
Es wurde ein Modell entwickelt, welches es ermöglicht, mit den Daten der
floristischen (Raster-)Kartierung eines Landes Aussagen über das Vorkommen
und die Häufigkeit von Habitattypen zu machen. Diese Methode könnte
in Ländern mit einer bestehenden floristischen Kartierung, aber fehlender Biotopkartierung, hilfreich sein, potenzielle Vorkommen seltener oder
geschützter Habitattypen lokalisieren und Artenverteilungen beurteilen
zu können. In Kapitel 3 wird der funktionelle Ansatz der Artausbreitung
aufgegriffen und die Methodenetablierung bei der Auswertung von
vorliegenden Ausbreitungsarten diskutiert. Anhand solcher Merkmalsdaten
ist es möglich, Habitate nach den jeweiligen Ausbreitungsmustern der
vorkommenden Artengruppen ökologisch zu charakterisieren. Im vierten
Kapitel wurden experimentell Modelle entwickelt, die es erlauben, anhand
von Diasporenmerkmalen Aussagen über Anhaftungspotenziale und somit
über die Epizoochorie von Pflanzenarten zu treffen. Im fünften Kapitel
werden die Auswirkungen der Autrophierung und Fragmentierung auf
Pflanzenpopulationen diskutiert. Dies wurde am Beispiel von basiphilen
(Halb-)Trockenrasenarten getestet. Die Autorin hat dazu verschiedene
funktionelle Merkmale für Persistenz und Ausbreitung von 91 Beispielarten
herangezogen.
Im sechsten und letzten Kapitel werden offene Fragen für zukünftige
Forschungsvorhaben dargelegt und Möglichkeiten für die Integration der
Ergebnisse in die Naturschutzpraxis vorgeschlagen.
Insgesamt eine sehr runde und innovative Arbeit, die theoretische Modelle
mit der Praxis verbindet und auf diese Weise Ideen für folgende
Forschungsprojekte eröffnet.
Steffen Boch
Kieler Notizen zur Pflanzenkunde 35 (2007), Seite 133