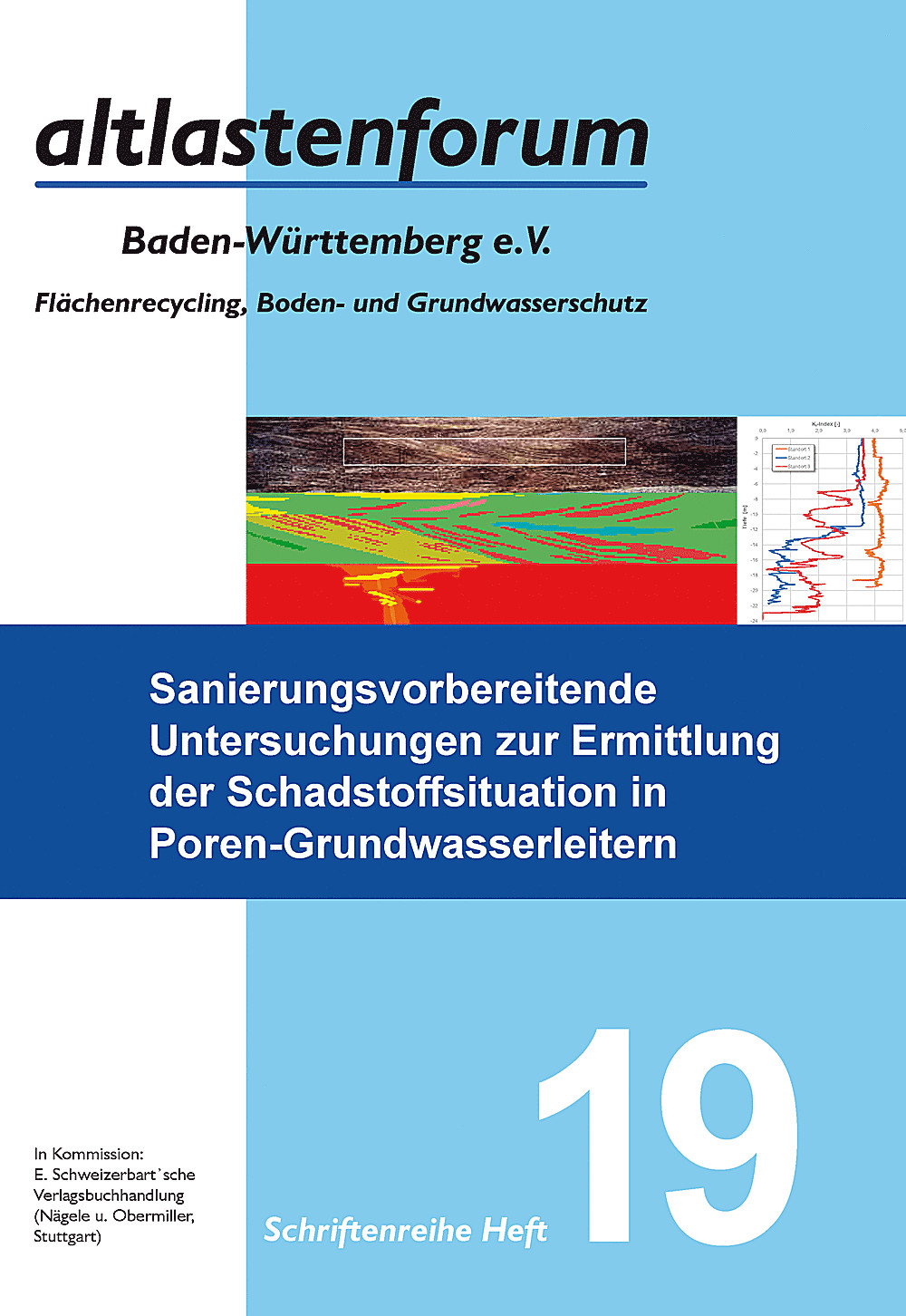Inhaltsbeschreibung nach oben ↑
Am Ende einer Detailuntersuchung liegen oft nicht ausreichende Daten
und Informationen für eine zielgerichtete und effiziente
Sanierungsplanung vor. Im Rahmen einer sanierungsvorbereitenden
Untersuchung müssen daher zusätzliche Informationen zur räumlichen
Verteilung der Schadstoffe und vor allem zu einer zuverlässigen
Abschätzung des Schadstoffinventars im wasserungesättigten und
-gesättigten Untergrund erhoben werden. Der vorliegende Statusbericht
befasst sich mit Untersuchungs- und Auswertemethoden, mit deren Hilfe
die Planung einer Sanierungsmaßnahme verbessert und vor allem die
Sanierungsdauer und die Sanierungskosten zuverlässiger abgeschätzt
werden können. Diese Untersuchungen und Auswertungen sind als
Ergänzung zu den in der Regel standardmäßig eingesetzten Methoden zu
verstehen. Die vorgestellten Methoden und Fallbeispiele beziehen sich
auf gesättigte Lockergesteinsgrundwasserleiter und auf organische
Schadstoffe. Die Vorgehensweise ist jedoch teilweise auch auf
Standorte mit anorganischen Schadstoffen und auf die ungesättigte
Bodenzone übertragbar.
Die grundlegenden Aspekte einer effzienten Sanierungsplanung sind ein
umfassendes Systemverständnis des Standorts, das in einem sogenannten
Konzeptionellen Standortmodell zusammengefasst wird. Die Kenntnis des
geologischen Aufbaus und der Heterogenität des Untergrunds sowie der
Schadstoffverteilung, -speicherung und des gesamten Schadstoffinventars
sind von essentieller Bedeutung. Es werden die wichtigsten Grundlagen,
Eigenschaften und Ansätze zur Beschreibung dieser Aspekte
erläutert. Insbesondere wird das 14-Compar-ment Modell (14-C Modell)
vorgestellt, mit dessen Hilfe eine Klassifizierung eines Schadens
hinsichtlich seiner Komplexität und damit seiner Zugänglichkeit für
eine Sanierung möglich ist.
Es werden Verfahren vorgestellt, mit denen die bodengebundenen
Schadstoffgehalte im Grundwasserleiter und die Schadstoffkonzentrationen
im Grundwasser bestimmt sowie Phasenkörper räumlich abgegrenzt werden
können. Zur Ermittlung der bodengebundenen Schadstoffkonzentrationen
wird die Anwendung von Direct-Push-Verfahren mit unterschiedlichen
Detektoren und Liner-Bohrungen diskutiert. Zur Bestimmung der
Schadstoffkonzentrationen im Grundwasser werden die unterschiedlichen
Grundwassermessstellentypen und Beprobungsverfahren dargestellt und
deren Anwendbarkeit für die Ermittlung des Schadstoffinventars
beschrieben. Die Untersuchungs- und Beprobungsverfahren werden
außerdem hinsichtlich ihrer Anwendung zur räumlichen Abgrenzung von
Phasenkörpern diskutiert.
Das Schadstoffinventar ist die zentrale Kenngröße für eine zuverlässige
Abschätzung der Sanierungsdauer und Kosten. Zur Abschätzung des
Schadstoffinventars wird der Zusammenhang zwischen den einzelnen
Messgrößen in den verschiedenen Kompartimenten erläutert und
beschrieben, wie man daraus das Schadstoffinventar bestimmt. Ein
wesentlicher Faktor, der die Genauigkeit des Schadstoffinventars
bestimmt, ist die Regionalisierung von Punktinformationen. Dazu werden
Vorgehensmöglichkeiten und Auswerteverfahren beschrieben, wie
z.B. Theissen-Polygone und andere Interpolationsverfahren.
Methoden zur Ermittlung der Heterogenität im Untergrund werden
vorgestellt. Die Anwendbarkeit von Bohrungen,
Direct-Push-Technologien, hydraulischen Untersuchungen und
Tracerversuchen wird im Hinblick auf Untersuchungen von
Schadstoffquellen und Schadstofffahnen diskutiert. Außerdem werden
geostatistische Verfahren zur Quantifizierung der Heterogenität
vorgestellt. Das Prinzip der numerisch-stochastischen Strömungs- und
Transportmodellierung wird erläutert. Anhand von Daten aus
Direct-Push-Sondierungen wird beispielhaft das sog. Lorenz-Verfahren
beschrieben. Mit diesem Verfahren kann die Heterogenität mithilfe von
hochaufgelösten eindimensionalen Datensätzen quantifiziert werden.
Die Fallbeispiele umfassen Schadensfälle mit unterschiedlichen
Schadstoffgruppen und unterschiedlicher Heterogenität des
Untergrunds. Bei einem LHKW-Schadensfall in stark heterogenem
Untergrund wird demonstriert, wie mit drei verschiedenen Methoden das
ursprüngliche und heute noch vorhandene Schadstoffinventar mit relativ
geringer Unsicherheit abgeschätzt werden kann. In einem zweiten
LHKW-Schadensfall wird gezeigt, wie an Hand der standardmäßigen
Untersuchung der Bodenluft, des Bodenfeststoffs und des Grundwassers
das Schadstoffinventar abgeschätzt und anhand der Daten aus der
Sanierung rückwirkend plausibilisiert werden kann. An einem weiteren
Projektbeispiels wird gezeigt, wie bei einem Teerölschaden nach
mehreren Jahren Sanierungsdauer festgestellt werden kann, wie groß die
Restbelastung heute noch ist und ob das residuale Teeröl rückgewonnen
werden kann. In einem vierten Fallbeispiel wird die Charakterisierung
des Schadens- bzw. Freisetzungspotentials von organischen Mischphasen
anhand von Feststoffanalysen gezeigt. Das letzte Fallbeispiel ist eine
BTEX-Kontamination in einem kleinräumig heterogenen Untergrund. Hier
wird dargestellt, wie sich die Heterogenität auf den Abstand von
Air-Sparging Injektionsbrunnen auswirkt.
Die für eine zielorientierte und effiziente Sanierung erforderlichen
Faktoren werden zusammengefasst. Als Fazit wird festgestellt, dass es
einerseits möglich ist, für einen Standort bereits vorhandene Daten
neu und effizienter auszuwerten. Andererseits können durch zusätzliche
Untersuchungen unter Verwendung standardmäßig eingesetzter
Untersuchungsmethoden ergänzende Daten gewonnen und durch spezielle
Auswertungen das Schadstoffinventar besser ermittelt werden. Dadurch
wird eine zuverlässigere Prognose der Sanierungsdauer und Kosten
möglich.