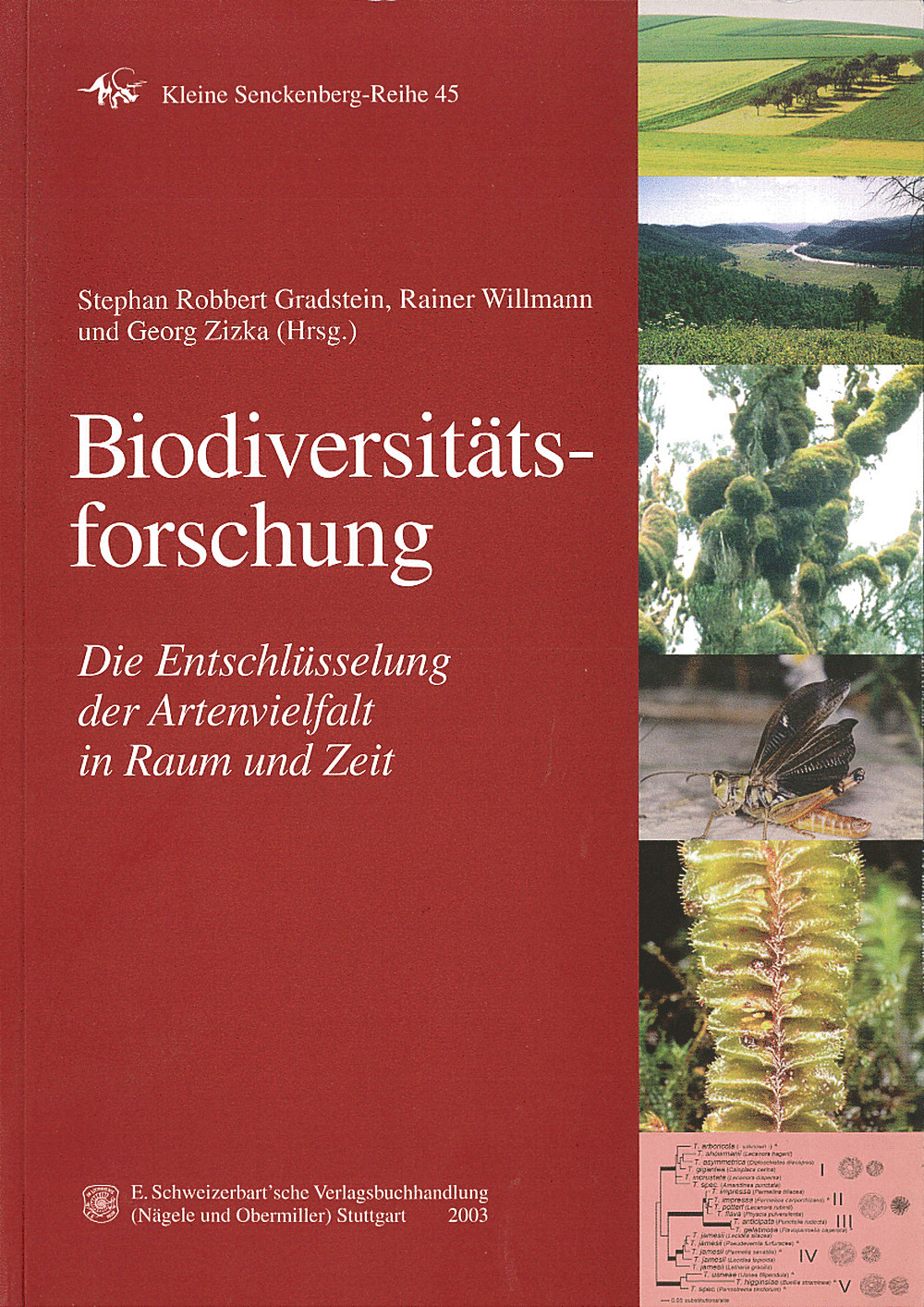Manche Wortschöpfungen sind ein Segen: sie sind selbsterklärend und
helfen, unsere komplizierte Welt gedanklich zu gliedern. Biodiversität
gehört leider nicht mehr dazu. So, wie vor 30 Jahren der Fachbegriff
Ökologie zu einem konturlosen Modewort zerfloss, so hat auch
Biodiversität in den zwei vergangenen Jahrzehnten eine zweifelhafte
Karriere gemacht. Jeder, der die Biodiversität im Titel einer seriösen
Publikation führt, muss zunächst erklären, was genau er meint. Die
Bedeutungen reichen von "Artenvielfalt" bis hin zu "Systemkomplexität
auf allen biologischen Ebenen".
Der 250 Seiten dicke Band ist eine Sammlung von 19 Aufsätzen aus der
Feder von Göttinger und Frankfurter Wissenschaftlern. Es handelt sich
ganz überwiegend um Übersichtsartikel, die einen Einblick in
Forschungsgegenstände und Fragestellungen geben sollen. Deren
Heterogenität zeigt, dass sich praktisch jedes Thema aus den Bereichen
Synökologie, Systematik oder Evolutionsforschung auf die - bislang
meist unerklärbare - Vielfalt ausrichten lässt und deshalb in einen
Sammelband über Biodiversität passt. In zwei Vorworten, einer
Einleitung und zwei einführenden Aufsätzen wird den Lesern versichert,
dass es sich um hochaktuelle Forschung von größter Relevanz und
weitreichender Bedeutung handelt, die sich in überregionalen
Forschungsnetzen zu einem interdisziplinären und modernen Fachgebiet
entwickelt.
Von den Arbeiten - etliche davon über außereuropäische Ökosysteme -
seien hier nur die angesprochen, die für die Botanik und den
Naturschutz in Hessen von Interesse sind:
Zizka et al. ("Blütenpflanzen: Biodiversitätsforschung - in den Tropen
und "vor der Haustür"") berichten von vielen unterschiedlichen
Aktivitäten der Frankfurter Arbeitsgruppen; "vor der Haustür" hebt ab
auf Untersuchungen im Frankfurter Stadtwald und auf die Kartierung des
Frankfurter Haupt- und Güterbahnhofs (vergleiche Bönsel et al., Band
38 der kleinen Senckenberg-Reihe, besprochen in BNH 15). Der Text
beschränkt sich eher auf allgemeine Ergebnisse. Konkrete Zahlen über
die Frankfurter Flora verbergen sich in einer stark verkleinerten und
gestauchten Grafik; der Sehtest beim Optiker ist dagegen ein
Kinderspiel. Dieser Artikel ist einer der wenigen, der auf die
Bedeutung wissenschaftlicher Sammlungen für Taxonomie, Ökologie und
Naturschutz hinweist.
Sehr solide, kritisch und zugleich anschaulich ist der Aufsatz von
Dierschke über räumliche und zeitliche Veränderungen in der
Krautschicht des Göttinger Kalkbuchenwaldes. Die 20-jährige
Untersuchung zeigt, wie Wald-Bingelkraut und Bärlauch in
Mischpopulationen als Gegenspieler "pulsieren". Die Ausdauer und
Sorgfalt, mit denen hier gearbeitet wurde, sind in der hektisch
(re)agierenden Forschungslandschaft eine Ausnahmeerscheinung
geworden. Das Ergebnis scheint schlicht. Es ist aber greifbar und hat
deutlich mehr Aussagekraft als manche spektakulär wirkenden Phänomene
bei anderen Autoren.
Einen sehr guten Zugang zum Thema "Gefäßpflanzen-Diversität in
Naturwaldreservaten" gibt der Aufsatz von W. Schmidt. Unter anderem
wird darin diskutiert, weshalb naturnah bewirtschaftete Wälder meist
artenreicher sind als standörtlich vergleichbare Naturwälder und wie
sich Windwurf auf das Struktur- und Artenspektrum auswirkt. Für ein
naturschutzfachlich begründetes Management von Waldökosystemen werden
interessante Anstöße gegeben.
Tscharntke et al. ("...Pflanze-Insekt-Interaktionen in
Kulturlandschaften") erläutern an Beispielen, welchen Einfluss die
Fragmentierung von Lebensräumen auf Räuber-Beute-Beziehungen,
Parasitierungs- und Bestäubungsraten hat.
Schließlich sei auf zwei Aufsätze hingewiesen, die die Geschichte der
menschlichen Wahrnehmung, Nutzung und Darstellung von Natur berühren
(Willmann: "Die Erfassung der Artenvielfalt vor Linné" und Hermann:
"Historische Humanökologie und Biodiversitätsforschung"). Beide
zeigen, dass jedes, auch unser heutiges Wissen über Organismen nicht
nur äußerst unvollständig ist, sondern trotz aller Fortschritte ein
Kind seiner Zeit und damit nicht frei von Subjektivität.
Die Ausstattung des Bandes, Papier, Satz, Layout und Bebilderung sind
sehr ansprechend. Leider wurde aber von einigen Autoren und von der
Redaktion zu wenig auf Verständlichkeit der Inhalte geachtet. Weiß die
"breitere Öffentlichkeit", an die sich der Band laut Professor
Steiningers Vorwort richtet, beispielsweise, was "competitive release"
ist? Wäre es nicht besser, einen zwei Worte längeren, aber
verständlichen Ausdruck zu benutzen, z. B. Entlastung durch fehlende
Konkurrenz? Kann man nicht statt vom "Red jungle fowl" vom
Bankiva-Huhn sprechen, das jedes Schulkind als Stammform des Haushuhns
kennen lernt? Die "breitere Öffentlichkeit" würde dann eher erreicht.
Günter Matzke-Hajek
Botanik und Naturschutz in Hessen Nr. 17, 2004