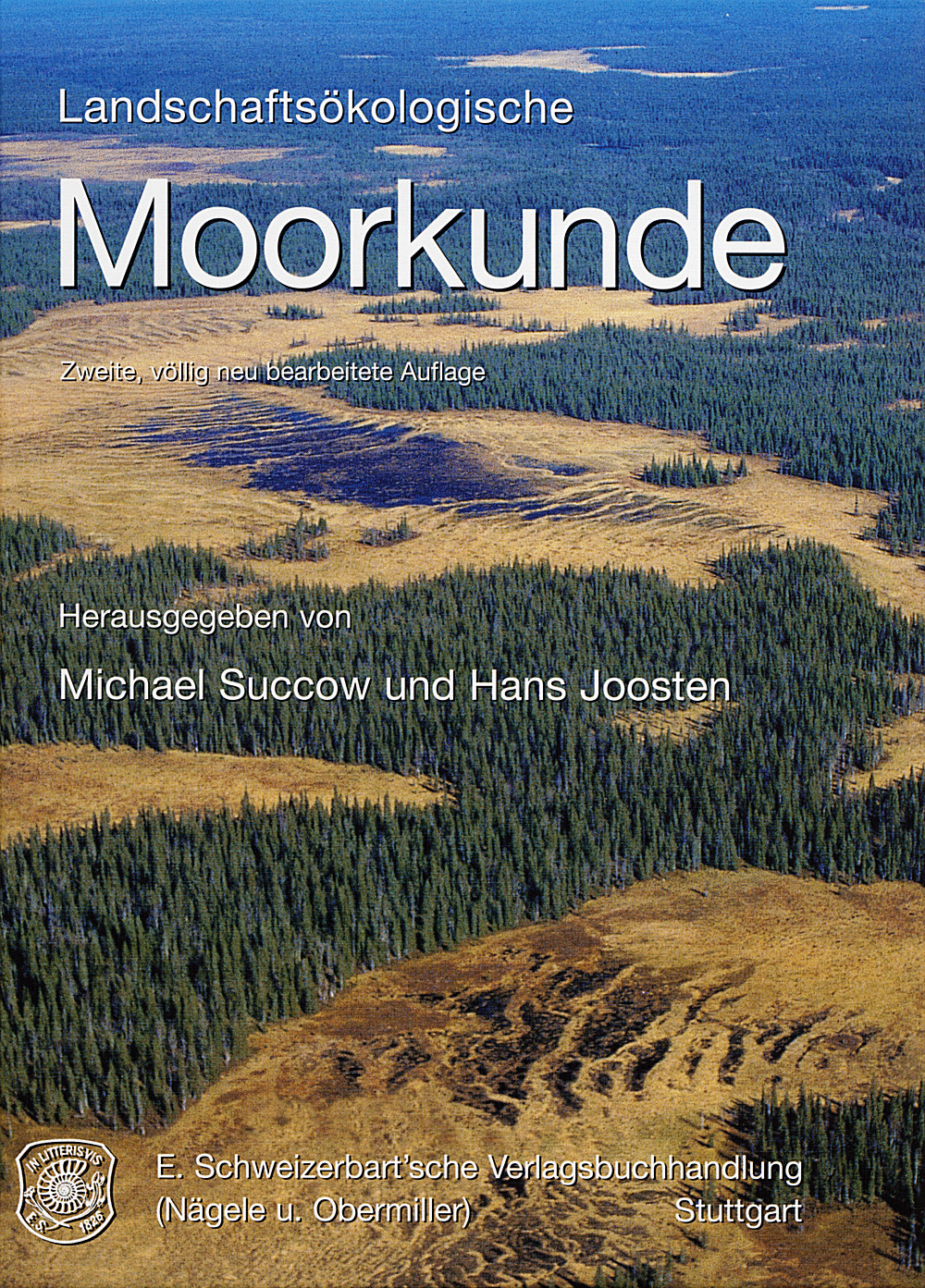Gute zwei Kilogramm Buch! War schon der Vorgänger ein Schwergewicht,
was die Bedeutung des Inhaltes anging, so kann sein Nachfolger dies
nun auch in Sachen Ausführlichkeit, Anschaulichkeit und Aktualität
behaupten. Dafür hat die zweite Auflage des deutschsprachigen
Standardwerkes für Moorkunde aber auch lange auf sich warten
lassen. Die ersten Ankündigungen und Subskriptionsangebote sind schon
doppelt und dreifach verjährt. Kein Wunder, werden Freunde des
"Moorpapstes" Prof. Dr. Michael Succow sagen. Sie wissen, dass der
Träger des alternativen Nobelpreises 1997 immer in Aktion, aber selten
daheim in Greifswald ist, um sich als Lektor zu verdingen. Meist weilt
er in den Weiten des Ostens, um mit seinem charismatischen Einsatz für
den Naturschutz, mit Hilfe seines guten Rufes und natürlich seinem
guten Draht zu den Regierenden einen Nationalpark nach dem anderen aus
der Taufe zu heben.
Aber auch für dieses neue Werk, das von Herrn Succow und dem
Paläoökologen Dr. Hans Joosten herausgegeben wird, gilt: Was lange
währt, wird endlich gut - um nicht zu sagen: erstklassig. Denn hinter
dem unauffälligen Titel "Landschaftsökologische Moorkunde" verbirgt
sich ein Kompendium des Wissens über Moore schlechthin. Wer etwas über
die Phosphor-Umsetzungsprozesse in Torfen wissen möchte, sich für die
hydraulischen Eigenschaften von Akrotelm und Katotelm interessiert,
wird hier ebenso fündig werden wie Personen, die nach einer
Klassifizierung der Moore suchen - nach welchen Kriterien auch immer:
Hier werden alle denkbaren Merkmale der Moore ausführlich dargestellt,
die Wechselbeziehungen und ökologischen Zusammenhänge anschaulich und
umfassend diskutiert. Die Klassifizierungen basieren auf einer
gewaltigen Datenfülle und sind somit bestens fundiert (Wie sonst
kommen wohl über 40 Seiten eng gedrucktes Literaturverzeichnis
zusammen?). Dabei ist ein Löwenanteil der Daten und der resultierenden
Klassifikationen ein Ergebnis genuiner Arbeit aus der
Forschungs-Umgebung der Autoren.
Der Aufbau des Buches spiegelt den klassischen naturkundlichen Ansatz
der bottom-up-Betrachtung wider: Es beginnt mit den Prozessen und
abiotischen Eigenschaften der Moore auf topischer Ebene und kommt über
die Vegetationskunde zur chorischen Betrachtung, zunächst aus
hydrologischer Sicht, dann aus einer ganzheitlichen
landschaftsökologischen Perspektive.
Für die Gemeinde der MoorkartiererInnen gibt es ein besonderes
Schmankerl: Die gesamte TGL 24 300/04, die bisher nur als vergilbtes
Blättchen in den Schränken der "alten Hasen" oder in den Archiven
weniger Bibliotheken aufzustöbern war, ist jetzt auf
alterungsbeständigem Papier vollständig neu abgedruckt. Dieser
DDR-Kartierstandard aus den 70er Jahren verhält sich gegenüber der
Bodenkundlichen Kartieranleitung Westdeutschlands wie ein Diamant zu
einem Stück Kohle. Dies soll mitnichten ein Affront gegen die AG
Bodenkunde sein, aber im Westen gab es eben nicht so viele Moore zu
kartieren...
Die Otto-Stiftung machte es möglich, dass in der Mitte des Buches 104
farbige Fotos einen eindrucksvollen Überblick über die Moore der Welt
geben. Die wissenschaftliche und private Herkunft der Autoren lässt
sich mithin nicht leugnen: So stammen die meisten Beispiele im Text
aus Nordostdeutschland, dieser Region ist sogar ein Hauptkapitel
gewidmet.
Last, aber mit Sicherheit not least, werden die anthropogenen
Veränderungen und Möglichkeiten zum Schutz der Moore diskutiert. Dabei
kommen bei den LeserInnen folgende Botschaften an:
- Das Prinzip: Moore spielen eine zentrale Rolle im Landschaftswasser-
und -stoffhaushalt. Sie bremsen den Wasserabfluss und speichern
Nährstoffe. Moorlandschaften sind geologisch jung und in unseren
Breiten oft selbsterhaltend, da hier die Bildungsbedingungen in vielen
Fällen schon längst nicht mehr vorherrschen. Daher ist die Zerstürung
der Funktionstüchtigkeit der Moore durch Entwässerung oft
irreversibel.
- Die Folgen: Der anthropoge, bereits stark beschleunigte
Wassertransport aus der Landschaft (Entwaldung, Bodenverdichtung und
-versiegelung, Dränage) wird auch durch die Moore, die oft den
Vorflutern wie Filter vorgeschaltet sind, nicht mehr
gebremst. Nährstoffe, die durch die Flächennutzung und durch den
beschleunigten Abfluss vermehrt mit transportiert werden, werden nicht
mehr heraus gefiltert - im Gegenteil: Die gespeicherten Stoffe werden
durch die Mineralisierung der Torfe remobilisiert. Und all dieses
Nährstoff überfrachtete Wasser landet zuerst in den Flüssen und dann
im Meer, der ultimativen Nährstofffalle, während die Landschaften des
Binnenlandes "austrocknen".
- Die Zukunft: Schutz der noch intakten Moore und Revitalisierung der
entwässerten Moore, wo immer es geht - allgemein: Entschleunigung des
Landschafts-Wasserhaushaltes, Förderung der landschaftsökologischen
Selbstreinigungskräfte.
Auch in diesen Kapiteln gilt wie in dem gesamten Werk die Maxime:
Beispiele sagen mehr als sophistische Klügeleien. Und: Erfolgreiche
Beispiele der Revitalisierung von Mooren motivieren zur
Nachahmung. Man denke nur an die vielfältigen Möglichkeiten, im Rahmen
der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung einen Eingriff in den
Landschafts-Wasserhaushalt mit der Revitalisierung eines Moores zu
kompensieren.
Einen Nachteil hat das Buch aber doch: Wenn es auch aufgrund seiner
Größe und Schwere nicht so leicht zu entwenden ist, so hat es doch
etwas, das wohl jede Bibliothekarin schwer seufzen lässt: eine
durchsichtige Lasche in der Innenseite des hinteren Buchdeckels mit
zwei Beilagen in äußerst kopierunfreundlichem Format. Wollen wir
hoffen, dass es in Zukunft genug BaföG geben wird, dass sich die
Studierenden das Buch kaufen oder die Beilagen (auf welche neuartige
Weise auch immer) vervielfältigen können, damit die Bibliotheken und
ihre Nutzer/innen lange etwas von diesem einzigartigen Werk haben
werden.
Ich wünsche dem Buch eine weite Verbreitung und den Mooren eine vitale
Zukunft!
B. Goldschmidt, Koblenz
Hydrologie und Wasserbewirtschaftung 46. 2002, H. 3, S. 152, 153