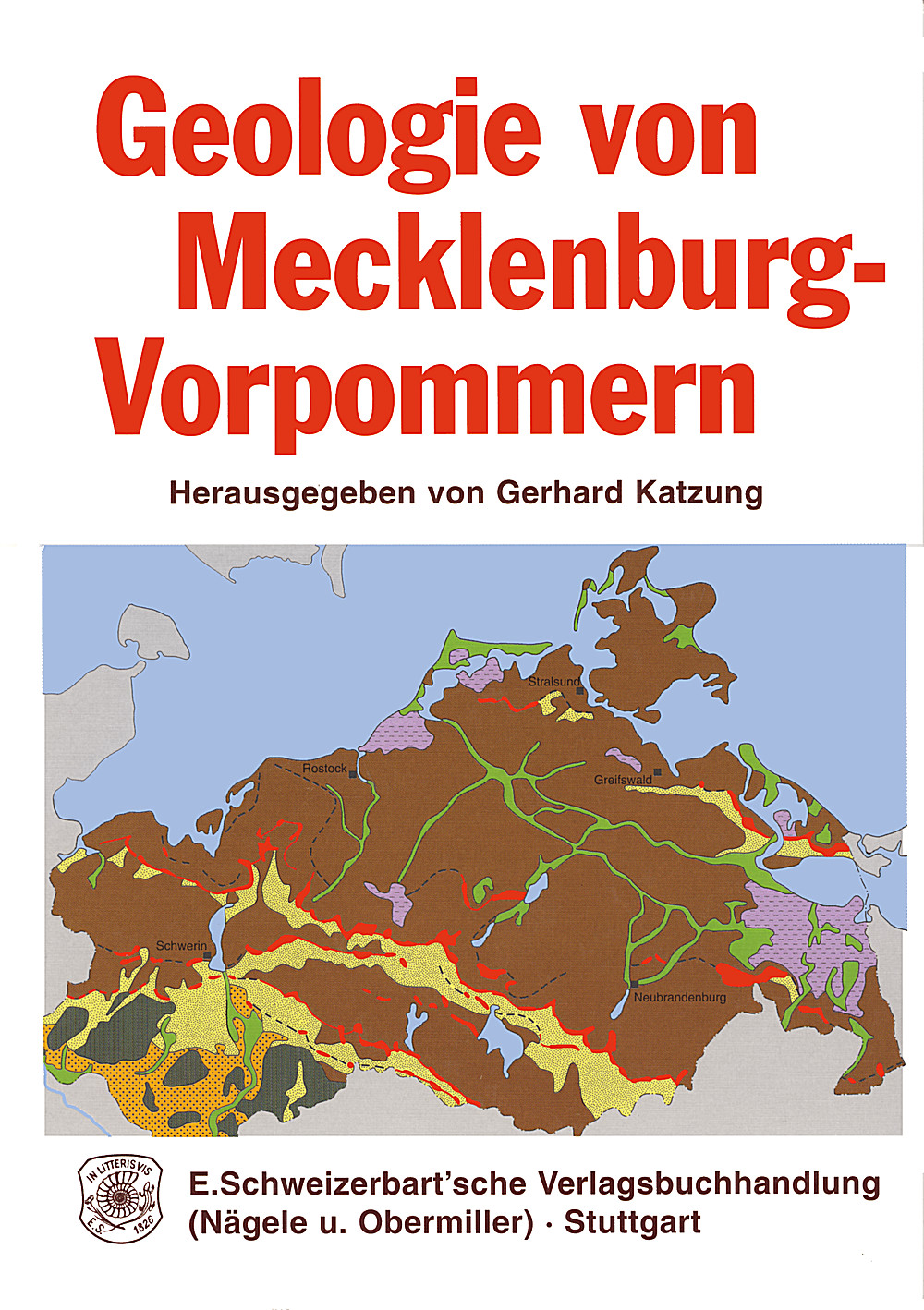Nachdem vor rund 50 Jahren zwei kürzere Veröffentlichungen zur Geologie des Raumes zwischen Trave- und Odermündung von S. v. BUBNOFF (1949) und K. v. BÜLOW (1952) erschienen waren, gab es keine zusammenfassende Darstellung zur Geologie von Mecklenburg-Vorpommern. Das wird jetzt mit Erfolg nachgeholt, denn endlich wurde nach der Wende die kleinliche Geheimhaltung von Bohrungen und vieler anderer geologischer Erkenntnisse aufgehoben. Nun konnte veröffentlicht werden, was bisher in verschlossenen Schränken ruhte. Von den 580 Seiten dieses Buches sind rund 70 S. den Literaturangaben, einigen Tabellen und dem Register gewidmet. Etwa 100 S. entfallen auf Angewandte Geologie einschließlich der Lagerstätten, dem Grundwasser, dem Küstenschutz, den Böden und den Umweltfragen. Die präquartären Gesteine, meist nur aus Bohrungen bekannt, werden auf 180 S. dargestellt. Sie können für die Oberflächengestaltung dort von Bedeutung sein, wo sie lokal durch glaziale Stauchung oder Schollentransport in die Nähe der Oberfläche gelangt sind. Auf das Quartär, das ganz Mecklenburg-Vorpommern (MV) überzieht, entfallen 140 S. - 40 Autoren haben zu diesem Werk beigetragen.
Die ältesten Ablagerungen führen bis in das Proterozoikum, bekannt aus einer auf -7 277 m Tiefe führenden Bohrung nordöstlich Schwerin. Ein anschauliches Bild der stratigraphischen Abfolge vermitteln 19 halbseitige Karten, die die regionale Verbreitung von Schichten vom Saxon (Rotliegendes) bis zum Miozän für den Raum zwischen Manchester und Minsk und Oslo und Prag darstellen.
Aus dem frühen Quartär zwischen dem Pliozän und der Elstereiszeit ist wenig bekannt. Nur die gut gerundeten Loosener Kiese (westlich Ludwigslust) weisen auf nordische Einflüsse hin. Die Elstereiszeit hat oberflächlich keine Ablagerungen hinterlassen, wohl aber in Tiefrinnen, in denen bei Hagenow 584 m mächtiges Quartär erbohrt wurde. Saaleeiszeitliche Ablagerungen treten im Südwesten auf etwa 10% der Landesfläche auf, sind dort aber stark periglaziär überarbeitet.
Dem gegenüber steht die Jungmoränenlandschaft der Weichseleiszeit, deren Beginn nach 10 000 Jahren Eemwarmzeit mit 110 000 B.P. angesetzt wird. Während man bisher annahm, dass die Weichseleiszeit erst im Hochweichsel vor etwa 20 000 Jahren bis auf deutschen Boden vorrückte, kennt man jetzt, aufgeschlossen am Kliff Stoltera westlich Rostock eine Mittelweichselmoräne über Eem und unter der ersten hochweichselzeitlichen Grundmoräne. Geomorphologisch hat dieser Warnowvorstoß genau so wenig Bedeutung wie ein gleich alter Vorstoß an der unteren Weichsel oder in Dänemark. Das Alter wird zwischen 50-60 000 B.P. angesetzt.
Hochweichselzeitlich sind 3 Grundmoränen bekannt, von denen die älteste die Brandenburger und die Frankfurter Endmoräne aufbauen. Die mittlere Grundmoräne gehört zum Pommerschen Stadium, die jüngste Grundmoräne zum Mecklenburger Vorstoß (Rosenthaler Eisrandlage). Eindeutig ist aber, dass es im Weichselhochglazial keine Interstadiale gab. Das Abschmelzen des Inlandeises von seiner maximalen (Brandenburger) Eisrandlage bis an die Ostseeküste lief innerhalb von nur zirka 5 000 Jahren ab! Das früher oft zitierte Blankenberg-Interstadial hat sich nirgends nachweisen lassen. Die sehr schnelle Folge von drei Weichselmoränen macht es schwer verständlich, dass "es nachweislich auch zum mehrfachen Abschmelzen bis in den Bereich der Ostsee gekommen sein soll (S. 286).
Die Küste erfuhr ihre Formung erst in den letzten 6 000 Jahren, als die Ostsee infolge des postglazialen Meeresspiegelanstiegs in die Nähe der heutigen Küste gelangte. Erst jetzt konnte sich die heutige Form der Kliffs und Nehrungen herausbilden. Zu beachten ist auch die Hebung Skandinaviens. Die Nulllinie der Hebung, - bisher durch die südliche Ostsee verlaufend gedacht -, zieht nach Auswertung der Daten aus den ersten 80 Jahren des 20. Jahrhunderts jetzt von Nordjütland durch Schonen zum Südende der Rigaer Bucht. Für die
Küste bei Lübeck wird sogar eine Senkung um 2,5 mm/Jahr, für den Stettiner Raum von 3 mm/Jahr angenommen. Das sind sicher momentane Werte, die man nicht hochrechnen darf, denn dann ergäben sich 5-6 m Senkung allein für die letzten 2 000 Jahre. Wenn auch die Kurven für den Meeresspiegelanstieg in der Ostsee einigermaßen übereinstimmen, so besteht doch eine deutliche Diskrepanz zum Anstieg in der Nordsee, wo vor 6 000 Jahren ein Stand von -5 m, in der Ostsee von -3 m erreicht wurde. Hier gibt es noch Klärungsbedarf.
Die Grundzüge der Oberflächenformen werden in einer "glazialen Morphologie dargestellt. Ihr folgt eine akribische Beschreibung der Kliffs, die auf längeren Strecken den besten Einblick in die meist komplizierten Lagerungsverhältnisse geben. Deren sorgfältige Aufnahme hat sehr dazu beigetragen, die stratigraphische Abfolge im Quartär abzusichern.
Dieser lang ersehnte Band, der jetzt in sorgsamer Redigierung und bester Ausstattung vorliegt, wird für Jahre ein Standardwerk bleiben und darf in keiner einschlägigen Bibliothek fehlen.
HERBERT LIEDTKE, Bochum