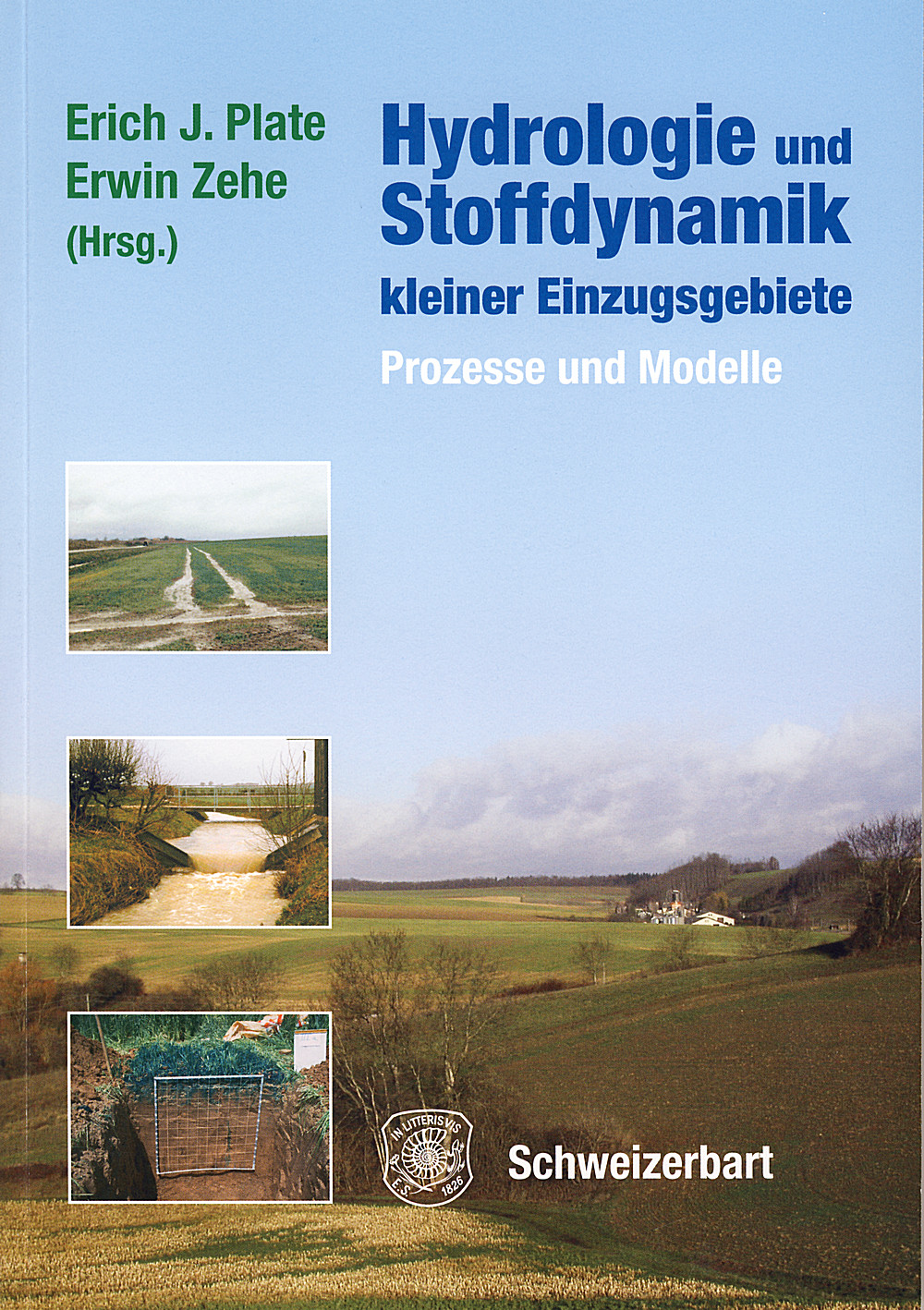Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie fordert eine gesamthafte
Betrachtung aller die Wassergüte beeinflussenden Faktoren. Nicht nur
punktförmige Einleitungen aus Kläranlagen etc. sollten bei einer
Bewirtschaftung des Gewässers berücksichtigt werden, sondern auch
flächenhaft aus einem – vornehmlich landwirtschaftlich genutzten –
Einzugsgebiet eingeschwemmte Verschmutzungen. Aus dieser
Fragestellung erwächst die Notwendigkeit, operative Werkzeuge für die
Simulation von Wasser- und Stoffflüssen als Basis einer Beurteilung
von Bewirtschaftungsvarianten zur Verfügung zu haben. Hierbei muss
nicht nur der Oberflächenabfluss sondern auch der oft mit
Düngestoffen und/oder Pflanzenschutzmitteln belastete unterirdische
Abfluss simuliert werden. Die relevanten Prozesse laufen bei
Hochwasser sehr rasch ab, bei Mittel- oder Niederwasser hingegen
langsam. Somit sollte ein Simulationsmodell Zeitskalen von wenigen
Minuten bis zu Monaten abdecken können und die physikalischen und
chemischen Vorgänge prozessnah beschreiben. Ein derartiges
Prozessmodell hat zu Ende der Achtziger Jahre des zwanzigsten
Jahrhunderts nicht existiert. Das Institut für Hydrologie und
Wasserwirtschaft (IHW) der Universität Karlsruhe stellte sich der
Aufgabe, ein solches Modell zu entwickeln und wählte als Modellgebiet
das Einzugsgebiet des 6,3 km² großen Weiherbaches in der
Lösslandschaft des Kraichgaues (zwischen Heidelberg und
Karlsruhe). Schon zum Zeitpunkt der Entstehung des Projektes war es
eines der Ziele, nicht nur eine für den Weiherbach maßgeschneiderte
Lösung zu finden, sondern das Modell als „virtuelle Landschaft“ für
andere, ähnliche Gebiete tauglich zu machen. Der Gesamtbericht über
das Weiherbachprojekt liegt in Form des oben genannten Buches vor.
Viele Teilprozesse des zu modellierenden Naturvorganges waren zu
Projektbeginn noch nicht ausreichend bekannt. Daher mussten
Spezialisten für viele der Aufgaben gefunden und ins Projekt
eingebunden werden. Wie viele Menschen an den Arbeiten beteiligt
waren, lässt sich nur an Hand der Zahl der Koautoren des
Gesamtberichtes, nämlich zweiundzwanzig, erahnen. Es dürften gut
hundert Personen gewesen sein, die hier bei Prozessstudien im Feld und
Modellierungsarbeiten am Computer tätig waren.
Diese Symbiose aus Feldforschung und Modellierungsarbeiten ist ein
hervorstechendes Kennzeichen des Weiherbachprojektes. Ein weiteres ist
das Skalenproblem. Einzelne Prozessstudien müssen auf quasi
punktförmigen Testflächen in der Größenordnung von Quadratdezimetern
durchgeführt werden, für andere dominante Prozesse ist der Schlag, für
weitere der Hang und schließlich das Einzugsgebiet
charakteristisch. Wie die Skalenübergänge zu vollziehen sind, war eine
Kernaufgabe des Projektes. Auf das Skalenproblem war daher auch das
hierarchisch gegliederte Messnetz ausgerichtet, um die
Identifizierbarkeit der Prozesse auf allen Skalen testen zu können.
Der Aufbau des Buches ist hierarchisch und nach den Skalen
gegliedert. Im ersten Kapitel wird ein Überblick über den Stand der
Forschung bei der hydrologischen Modellierung für die Punkt-, Hang-
und Einzugsgebietsskale gegeben. Kapitel 2 fasst die Modellansätze zur
physikalisch orientierten Beschreibung des Wasser- und
Stofftransportes unter Berücksichtung der Skalen zusammen. Besonderes
Augenmerk wird hier auf die Zusammenhänge zwischen den dominanten
Prozessen des Wasser- und Stofftransportes und der räumlichen
Variabilität der Schlüsselparameter im Boden und an der Erdoberfläche
gerichtet. Im 3. Kapitel wird das Testgebiet Weiherbach ausführlich
charakterisiert. Das 4. Kapitel widmet sich ausführlich den
Prozessuntersuchungen im Detail und ihren Ergebnissen: Bodenkarte,
bodenhydraulische Parameter, Makroporen und praeferenzielle
Fließwege, Energie-, Feuchte-, Wasser- und Stoffbilanzen werden
skalenübergreifend analysiert. Landwirtschaftlich relevante Stoffe
(Bodenteilchen, Stickstoff, Herbizide, …) und ihre Flüsse und
Bilanzen werden erforscht und die Bodenerosion mit Hilfe von
Beregnungsversuchen untersucht. In diesem Zusammenhang sei auf das
Schlusskapitel 4.5 dieses Abschnittes 4 verwiesen, in dem eine globale
Zusammenfassung gegeben und auf die der Konzeption eines
hydrologischen Messnetzes immanenten Probleme hingewiesen wird. Im
5. Kapitel werden Wasser- und Stoffflüsse auf allen Skalen simuliert,
die Ergebnisse validiert und Modellsensitivitäten und –unsicherheiten
quantifiziert. Das 6. Kapitel bringt eine Zusammenschau und einen
Ausblick.
In Summa kann man dieses Buch ruhig als ein beachtliches Werk
bezeichnen. Ein hervorstechendes Kennzeichen ist die Verbindung von
Tiefe und Breite der Forschungsarbeiten, die sich in dieser
Publikation niederschlagen. Als Leser hat man Möglichkeiten, die dem
EDV-Nutzer aus digitalen Landkarten, Geographischen
Informationssystemen und Bildbearbeitungsprogrammen geläufig sind:
Zooming in und zooming out. Wer z.B. wissen will, wie man
Regenwurmlöcher ausmessen kann, um ihren Einfluss auf die Infiltration
und die Entstehung von schnellem Zwischenabfluss abzuschätzen, wird
Hinweise hierzu ebenso finden wie einen klaren Überblick über
Modellansätze zur Beschreibung des Abflusses in bevorzugten
Fließwegen des Untergrundes. Dasselbe gilt für alle Probleme des
Wasser- und Stoffhaushaltes, die im Bericht behandelt werden. Insofern
kann diese Publikation geradezu als Handbuch gesehen werden. Es
schafft Überblick und Einblick. Dazu trägt auch die sorgfältig
bearbeitete und aus allen Kapiteln des Buches zusammengeführte
Literaturübersicht ganz wesentlich bei.
Es ist unvermeidlich, dass die Untersuchungsmethoden, die Resultate
der Detailuntersuchungen und wohl auch das hieraus abgeleitete
Gesamtmodell stark mit dem Naturraum verbunden ist, in dem die
Arbeiten durchgeführt worden sind, also mit landwirtschaftlich
genutzten Flächen auf Löss und unter den klimatischen Bedingungen des
Kraichgaues. Ungeachtet dessen sind viele wertvolle Hinweise zur
Methodik der Feldforschungen zu gewinnen, und auch Detailergebnisse,
mit Vorsicht und Verstand verwendet, sind übertragbar auf andere
Naturräume. Faustformeln, wie sie sehr oft im Ingenieurwesen
angewendet werden, wird man Gott sei Dank vergeblich suchen. Wollte
man unbedingt ein wenig kleinliche Beckmesserei walten lassen, könnte
man bekritteln, dass in einzelnen Teilberichten relativ oft der
Begriff „vergleichbar“ auftaucht, ohne dass genauer definiert würde,
was unter dieser Vergleichbarkeit zu verstehen ist. Der Leid gewohnte
Naturwissenschaftler wird sich daran eher nicht sehr stoßen.
Die Arbeit der Herausgeber kann nicht hoch genug eingeschätzt
werden. Trotz der großen Zahl von zweiundzwanzig Koautoren und ihrer
unterschiedlichen Methoden und Arbeitsweisen ist ein Buch „aus einem
Guss“ entstanden. Dies wird erreicht durch die jeden größeren
Abschnitt begleitende Einleitung und Zusammenfassung. Es ist leicht
vorstellbar, dass die Arbeit der Editoren nicht leicht war, bis das
Werk in seiner abgerundeten Form abgeschlossen war. Hinweise auf
Schwierigkeiten und ungelöste Probleme sind ein wichtiger Bestandteil
der Abrundung der Arbeit!
Der Publikation „Hydrologie und Stoffdynamik kleiner Einzugsgebiete –
Prozesse und Modelle“ ist eine weite Verbreitung in Fachkreisen zu
wünschen, und das aus den umfangreichen Arbeiten im Weiherbachgebiet
entwickelte Modell CATFLOW verdient es, auch in anderen
Einzugsgebieten angewendet und weiter entwickelt zu werden. Richtung
weisende Arbeiten laufen Gefahr, lange Zeit nicht angenommen zu
werden. Möge diese Erfahrung hier nicht gelten! Der auf der letzten
Umschlagseite stehenden Bemerkung „Diese abgestimmte Kombination von
Theorie, Feldmessung und numerischer Modellierung ist zukunftsweisend
für die moderne Hydrologie“ ist nichts hinzu zu fügen.
Dr. Robert Kirnbauer, TU Wien
Hydrologie und Wasserbewirtschaftung Heft 2 (April) 53. Jg. 2009 S. 122/123