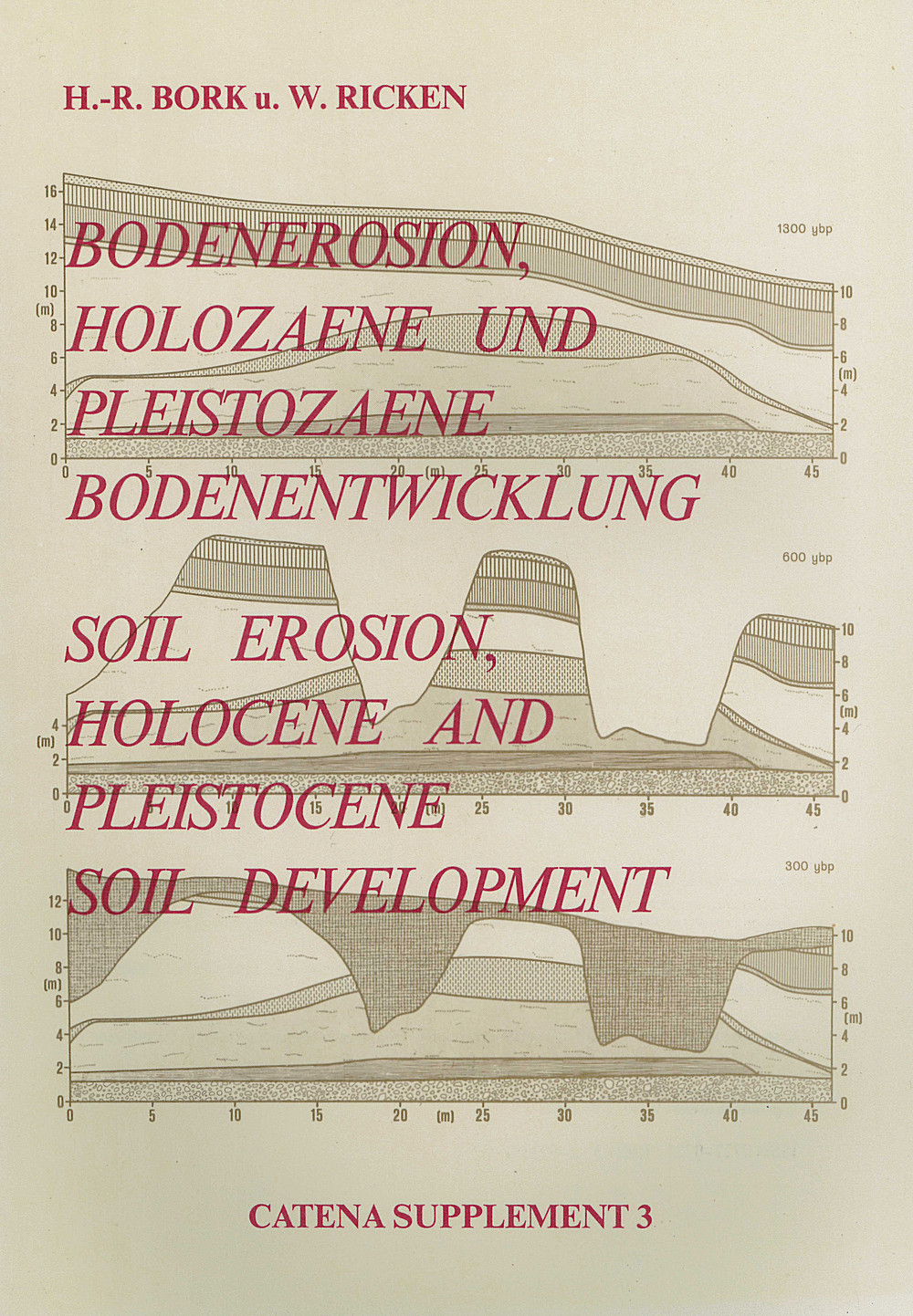Inhaltsbeschreibung Haut de page ↑
Mit dem Ziel, die Kenntnis über holozäne Pedogenese und Morphogenese
und ihre Wechselbeziehungen zu vertiefen, wurde ein Teil des
Südniedersächsischen Berglandes untersucht, das Untereichsfeld und das
südwestliche Harzvorland. Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich
zwischen Northeim, Osterode am Harz und Duderstadt. Stratigraphische,
pedologische und sedimentologische Untersuchungen wurden an über 800
Lößstandorten durchgeführt. Besondere Aufmerksamkeit wurde der
quantitativen Erfassung und Analyse der mittelalterlichen und
neuzeitlichen Bodenerosion gewidmet.
Folgende Ergebnisse seien hervorgehoben:
Im Altholozän entwickelte sich in Löß unter einer geschlossenen
Walddecke ein an den Hängen 35 bis 40 cm und in feuchten Auen 20 bis
30 cm mächtiger Humushorizont (Hang: Bodentyp Schwarzerde; Aue:
Bodentyp Pararendzina).
Vom Neolithikum bis zur mittleren Römischen Kaiserzeit wurde die durch
Bodenbildung unter Waldvegetation geprägte holozäne
geomorphodynamische Stabilitätsphase vereinzelt kurzzeitig durch
Waldrodungen unterbrochen. Innerhalb der ackerbaulich genutzten
Rodungsinsein fanden, verursacht durch wenige mäßig erosive
Abflußereignisse, schwache Bodenumlagerungen statt. Auf den
ungerode-ten Flächen schritt die Bodenbildung fort.
Von der jüngeren Römischen Kaiserzeit bis zum frühen Mittelalter war
das Untersuchungsgebiet vollständig bewaldet.
In feuchten Auen führte die Pedogenese bis zum frühen Mittelalter zur
Entkalkung, Verbräunung und schwachen Tondurchschlämmung der
Pararendzina und der obersten Dezimeter des liegenden Lösses. Die
durchschlämmten Pararendzinen der feuchten Talauen waren im
Frühmittelalter im Untersuchungsgebiet in der Regel 50 bis 90 cm
mächtig. An den Hängen verlief die Bodenbildung vergleichsweise rasch
ab. Bis zum Frühmittelalter hatten sich an den Hängen in Löß
Parabraunerden mit einer Mächtigkeit von 2 bis 3 m im Untereichsfeld
und von 3 bis 4 m im feuchteren südwestlichen Harzvorland gebildet.
Im späten Frühmittelalter und im Hochmittelalter wurde das
Untersuchungsgebiet fast vollständig gerodet und ackerbaulich genutzt,
die Bodenbildung und die geomorphodynamische Stabilitätsphase dadurch
beendet. Mäßig erosive Abflußereignisse hatten schwache
Bodenumlagerungen zur Folge.
Im Spätmittelalter verursachten Extremabflüsse äußerst starke lineare
und flächenhafte Erosion im Ackerland. Bis über 10 m tiefe Schluchten
rissen ein. Vielfach bildeten sich einige hundert Meter lange und
mehrere Dekameter breite Hang- und Talbodenpedimente. Weite Flächen
fielen wüst und bewaldeten sich wieder. Unter diesem Wald bildeten
sich in spätmittelalterlichen Sedimenten (Kolluvien) in wenigen
Jahrhunderten kräftig entwickelte Parabraunerden.
Die Neuzeit war mit Ausnahme des 18. Jahrhunderts durch geringe
Bodenumlagerungen im Ackerland geprägt. Im 18. Jahrhundert entstanden
während der zweiten holozänen Zerschneidungsphase zahlreiche tiefe
Runsen.
Im Mittelalter und in der Neuzeit wurden im Untersuchungsgebiet durch
starke Erosion insgesamt 493 600 000 m3 Boden
umgelagert. An den Hängen des Untersuchungsgebietes wurden im Mittel
die obersten 232,3 cm erodiert. Dies' entspricht einem mittleren
jährlichen Abtrag von 48 Tonnen je Hektar. 87,57o des erodierten
Materials wurde auf den Hängen und in den Auen des
Untersuchungsgebietes akkumuliert. 12,57o bzw. 61 860 000
m3 wurden durch die Rhume aus dem Untersuchungsgebiet
ausgetragen.