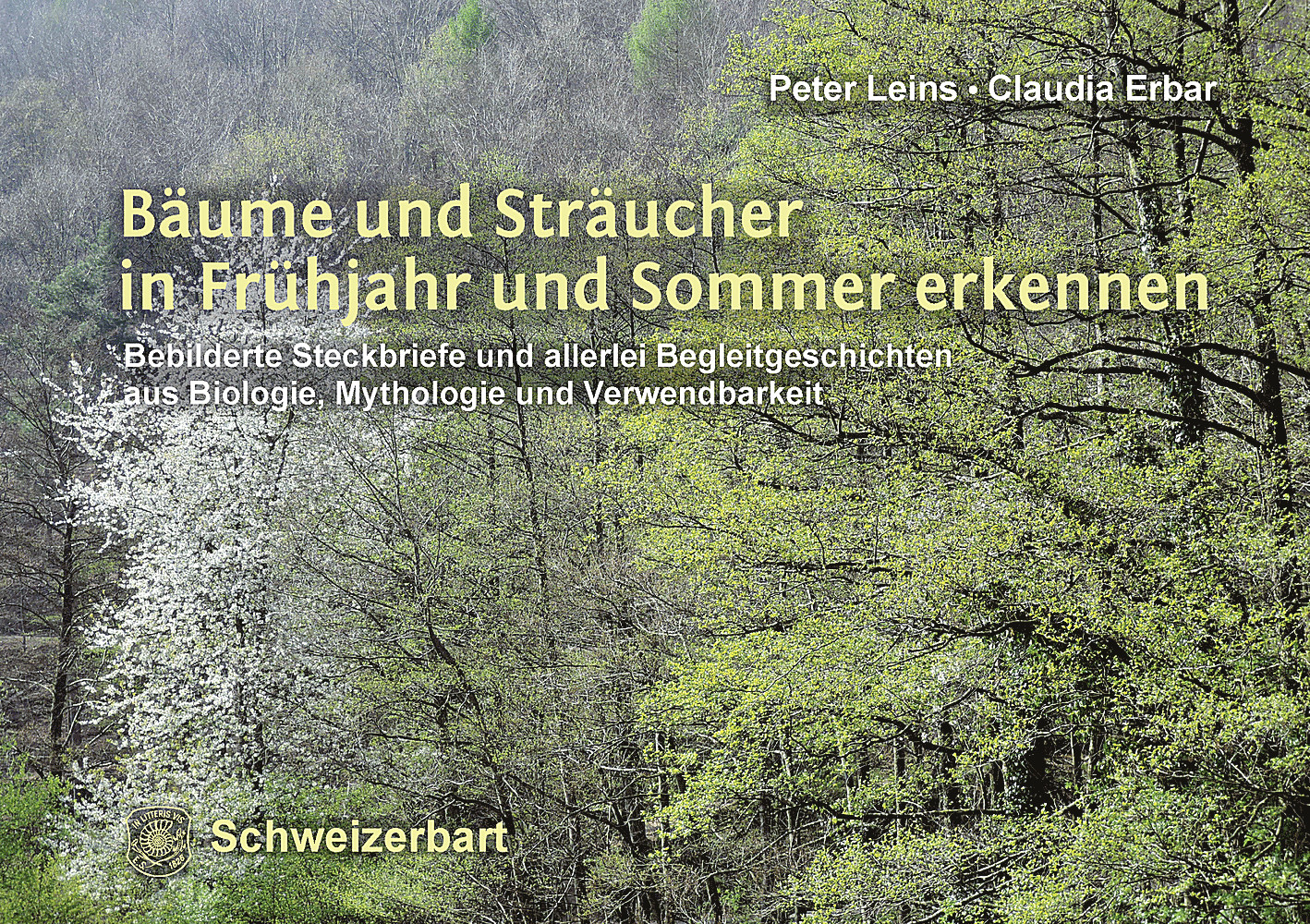Inhaltsbeschreibung Haut de page ↑
Das erfolgreiche Buch mit dem Titel „Bäume und Sträucher in Herbst und
Winter erkennen“ hat ein Pendant bekommen. Darin werden nun die
gleichen Bäume und Sträucher – insgesamt 77 heimische, eingeführte und
eingebürgerte Arten – in der gleichen Reihenfolge und mit denselben
Kennnummern in Frühjahr und Sommer vorgestellt. Während dieser
Jahreszeiten bieten die Holzgewächse mit Blättern, Blüten,
Blütenständen und reifenden Früchten eine Fülle von Merkmalen. Die zu
ihrer Erkennung wichtigen Merkmale sind auf großen farbigen Bildtafeln
mit knappen Steckbriefen zusammengestellt. Die Bildtafeln dienen der
Überprüfung einer ersten schnellen Bestimmung nach Blattformen. Durch
einen direkten Formvergleich in einem Bilderschlüssel ist die
Bestimmung vergnüglicher als unter Zuhilfenahme nicht bebilderter,
„trockener“ Bestimmungstabellen. Eine leicht verständliche Einführung
mit eingefügten Graphiken vermittelt dem Benutzer wichtige
Grundkenntnisse zur Biologie von Holzgewächsen und regt zur eigenen
Beobachtung an. Neue Begleitgeschichten zu jeder Baum- und Strauchart
aus Biologie, Mythologie und Verwendbarkeit machen auch dieses Buch zu
einem unterhaltsamen Wegbegleiter auf Spaziergängen.
Das Buch ist in erster Linie für den interessierten Laien und
Gehölzliebhaber, für Lehrer und Schüler, Eltern und Großeltern
konzipiert. Auch für Studierende der Biologie mag es als erste
„Tuchfühlung“ mit der Biodiversität der Pflanzen eine willkommene
Lektüre sein.