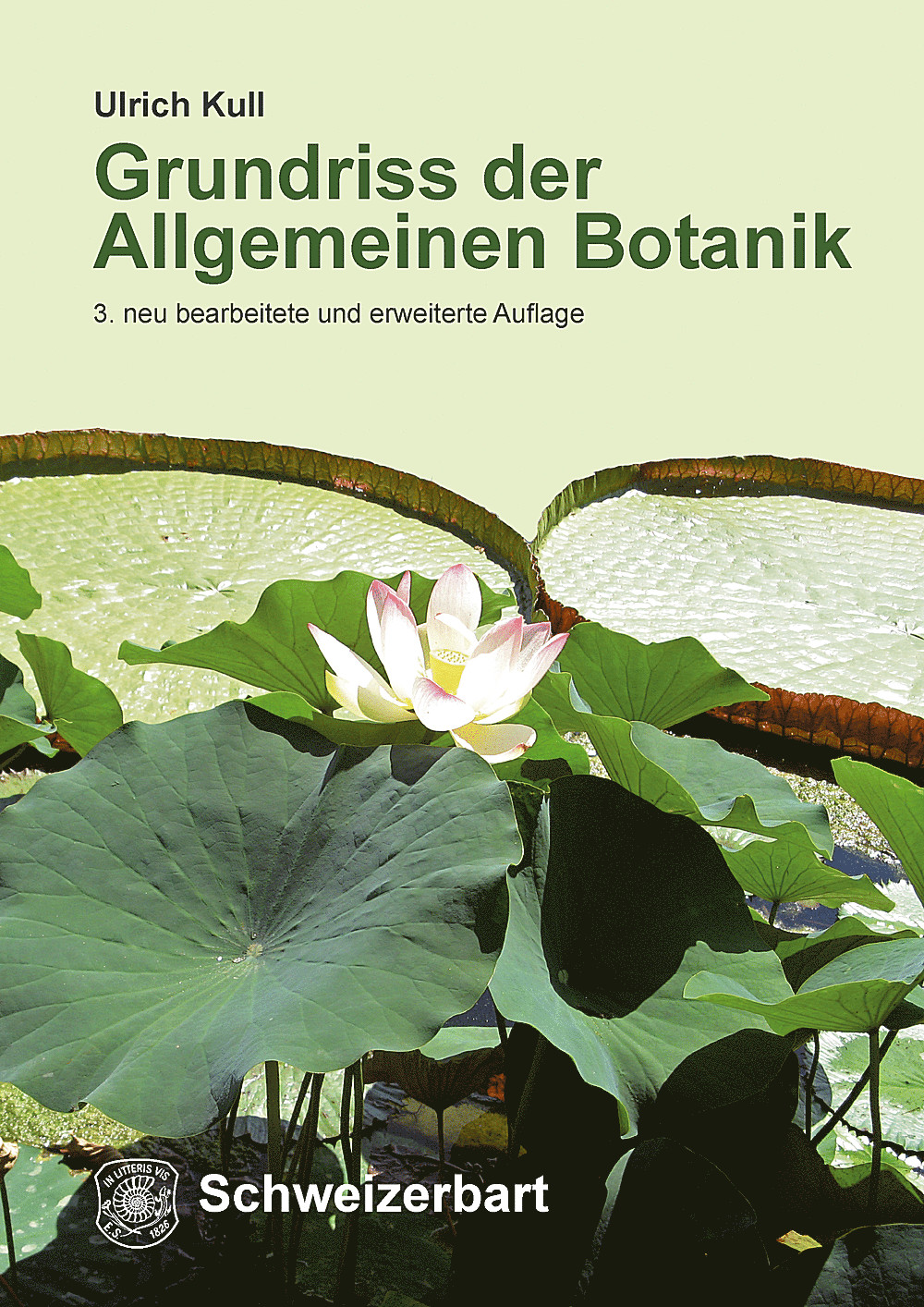Inhaltsbeschreibung Haut de page ↑
Diese bereits dritte Neuauflage von Kulls Grundriss der Allgemeinen
Botanik wurde vollständig überarbeitet. Sie führt in sämtliche Aspekte
der Pflanzenwissenschaft ein: von Molekül und Pflanzenzelle über
Evolution, Histologie, Fortpflanzung und Genetik bis hin zu
Pflanzenstoffwechsel und Ionenhaushalt.
Themen, die von der Botanik in andere Bereiche wie die Ökologie,
Evolutionsbiologie oder Mikrobiologie überleiten, werden besonders
herausgehoben. Molekularbiologie und Zellbiologie werden so weit
behandelt, wie es das Verständnis der weiteren Kapitel erfordert. Das
unerlässliche chemische und physikochemische Grundwissen wird knapp,
aber dennoch verständlich dargestellt.
Pflanzenanatomie und Morphologie werden, modernen Anforderungen
entsprechend, mit Ökologie und mit Entwicklungsphysiologie, Bionik und
Biotechnologie verknüpft. In weiteren Kapiteln geht der Autor auf den
Energiehaushalt (Photosynthese, Atmung), den Stoffwechsel der
Pflanzen (Kohlenhydrate, Lipide, Stickstoffverbindungen) und deren
bestimmende Faktoren ein. Kapitel über Wasser- und Nährstoffhaushalt,
Symbiose sowie Entwicklung und Wachstum, Stressphysiologie und
Bewegungen der Pflanzen schließen sich an.
Erstmals werden in einem einführenden Lehrbuch die Grundlagen der
Biologie im Zusammenhang mit den Funktionen lebender Organismen
dargestellt. Hierzu werden auch die notwendigen
ingenieurwissenschaftlichen und physikalischen Methoden erläutert.
Die knappe und klare Darstellung sowie zahlreiche Abbildungen und
Schemata machen das Buch zu einer ausgezeichneten Lernhilfe sowohl für
Studierende der Biologie, der Botanik und der Technischen
Biologie. Für Lehrende und Studierende anderer Fächer, die Botanik als
Nebenfach gewählt haben, ist es zur Begleitung und Ergänzung von
Vorlesungen ebenfalls sehr gut geeignet.