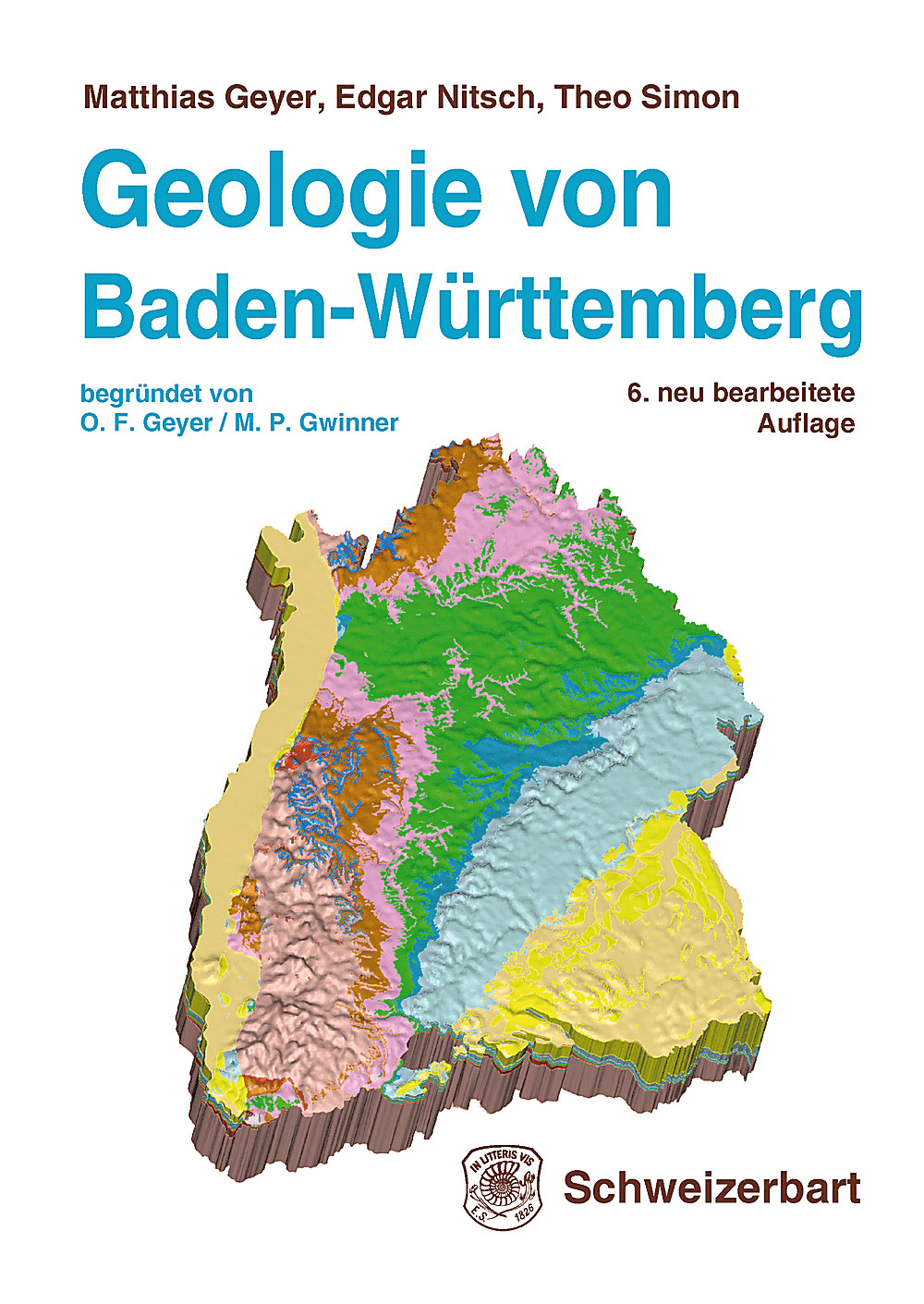Was für eine Herausforderung war es, einen wahren Klassiker der
Geologie, wie die „Geologie von "Baden-Württemberg“ der beiden Autoren
Otto Franz Geyer (1924-2002) und Manfred Paul Gwinner (1926-1991)
sich vorzunehmen und zu überarbeiten, um das Werk in neuem Lichte
erstrahlen zu lassen, damit es wie sein Vorgänger einen ebenso hohen
Stellenwert sowohl bei Fachleuten als auch bei interessierten Laien
genießen sollte? Das alte Buch bis zur 4. Auflage (1991) war ein
Standardwerk für alle Dozierenden und Studierenden der
Geowissenschaften – zumindest im süddeutschen Raum, wenn sie
Geländeveranstaltungen vor- und nachbereitet sowie auf Prüfungen zur
Regionalen und Historischen Geologie gelernt haben. Aber auch im
Bereich der Baugeologie war das Werk neben den geologischen Karten in
der Regel das erste Nachschlagewerk bei der Planung, Erkundung,
Durchführung und Betreuung von Bauprojekten, um sich über die
regionale Geologie des jeweiligen Projektes fundiert zu informieren
und umfangreiche Zitate für das weitergehende Literaturstudium zu
finden – sei es beispielsweise für den Michaelstunnel in Baden-Baden
oder für den Meisterntunnel in Bad Wildbad.
Demnach waren die Erwartungen an die 5. völlig neu von Matthias Geyer,
Edgar Nitsch und Theo Simon bearbeitete Auflage von 2011 sehr hoch
und die Befürchtung, dass ein grundsolides, altbewährtes Werk
„kaputtmodernisiert“ werden könnte, war von vielen Fachleuten im
Vorfeld zu hören. Aber alle Erwartungen wurden erfüllt – in einigen
Teilen sogar erfreulicherweise mehr als erfüllt – und die Befürchtung
verflüchtigte sich schnell. Das Werk in seinem neuen, farbigen Kleid
kann weiterhin als Standardwerk sowohl für Dozierende sowie
Studierende als auch für interessierte Laien gelten und beweist sich
laufend bei Bauprojekten, wie z.B. auch bei den Großprojekten
Stuttgart 21 und den Albaufstieg, als wichtige Informationsquelle und
wertvoller Begleiter für die dort tätigen Ingenieurgeologinnen und
Ingenieurgeologen. Die neue, rein stratigraphische Gliederung ist
absolut sinnvoll und nachvollziehbar, doch vermisst man als „Kenner“
der alten Auflage auch etwas das ehemalige Kapitel „Die Regionale
Geologie“, in dem für den Leser sehr bequem die einzelnen Regionen
ohne stratigraphische Grenzen vorgestellt wurden. Beispielsweise der
Odenwald, bei dem in einem Kapitel der Kristalline Odenwald und der
Buntsandstein-Odenwald zusammengefasst waren; nun muss man sich die
einzelnen Abschnitte aus den einzelnen stratigraphischen Teilen für
die Regionale Geologie des Odenwaldes zusammensuchen, man gewöhnt
sich jedoch sehr schnell daran.
Aber die Zeit bleibt nicht stehen, neue Erkenntnisse werden bei
Bauprojekten laufend gewonnen und die Forschung macht nicht Halt, so
dass nun die 6. neu bearbeitete Auflage vorliegt, in die die jüngsten
Erkenntnisse und Forschungsergebnisse eingearbeitet sowie die
Nomenklatur und Stratigraphie den modernsten wissenschaftlichen
Fachstandards angepasst wurden.
Da es in den letzten Jahren gerade auch im Bereich der Stratigraphie
des Quartärs viele neue Erkenntnisse gab und in Baden-Württemberg
versucht wird, neue Wege zu beschreiten, die sich stellenweise weit
von der klassischen, auf Albrecht Penck (1858-1945) zurückgehenden
Gliederung des Quartär entfernt haben, möchte ich exemplarisch zwei
Punkte aus dem Unterkapitel 3.5 Kreide bis Quartär herausgreifen:
a) Die Autoren versuchen in Abb. 104 (S. 288) das Alte mit dem Neuen
zu verknüpfen, was eine wahrlich hehre Aufgabe ist. Leider gelingt
ihnen dies nur bedingt. Bspw. werden in der Spalte Alpenvorland
klimatisch definierte stratigraphische Begriffe wie Hoßkirch-, Riss-
und Würm-Kaltzeit mit Schotterakkumulationen
(z.B. Donau-Deckenschotter) gleichwertig dargestellt, ohne darauf in
der Abbildungsunterschrift näher einzugehen oder einen Querverweis auf
ein folgendes Kapitel zu setzen. Da eine Erläuterung fehlt, entsteht
der Eindruck, dass die Donau-Deckenschotter – zeitlich betrachtet –
vollständig die Donau-Kaltzeit repräsentieren und sich die
Donau-Kaltzeit über das gesamte Gelasium (2,58 bis 1,8 Ma)
erstreckt. Ähnliches gilt für die Günz- und Mindel-Deckenschotter.
Da die auch bei Laien weit bekannten Hoch- (aus der Riss-Kaltzeit) und
Niederterrassen-Schotter (aus der Würm-Kaltzeit) in der Abb. 104
nicht mehr auftauchen, wären hier ein paar erklärende Worte
hilfreich. Gleiches gilt für die früher in Baden-Württemberg zwischen
der Günz- und Mindel-Kaltzeit eingeschobene Haslach-Kaltzeit, die nun
„verschwunden“ ist. Dafür taucht an anderer Stelle zwischen der
Mindel- und Riss-Kaltzeit nun die Hoßkirch-Kaltzeit auf. Auch hierfür
fehlt eine kurze Erläuterung. Auch der Text im Unterkapitel 3.5.4.9
erklärt nicht das „Verschwinden“ der Haslach-Kaltzeit. Um was es
sich bei der Steinental-, Dietmanns-, Ilmensee- und
Hasenweiler-Formation handelt, bleibt leider auch unklar und in
welchem Verhältnis sie zur den Schotterakkumulationen stehen.
Bspw. deckt die Steinental-Formation über einen längeren Abschnitt
denselben Zeitraum ab wie die Mindel-Deckenschottern, was auch nicht
näher erläutert wird. Gibt es jetzt im Alpenvorland parallel zwei
geologische Einheiten oder eine Einheit mit unterschiedlichen Namen
und stratigraphischen Grenzen? All diese fehlenden Erläuterungen
machen es schwer bis unmöglich, die Abb. 104 für das Alpenvorland
richtig zu verstehen und nachzuvollziehen. Hier wären entweder eine
Überarbeitung und ausführlich erläuternde Abbildungsunterschrift oder
ein Zweiteilung der Abbildung oder eine intensivere Verknüpfung mit
dem Text in Kap. 3.5.4.9 Ziele für eine 7. Auflage.
b) Im Gegensatz dazu gelingt es den drei Autoren ausgesprochen gut,
die neue, doch sehr komplexe, v.a. auf Dietrich Ellwanger
zurückgehende lithostratigraphische Gliederung in Formationen
nachvollziehbar darzustellen, wofür ich ihnen ein großes Lob
aussprechen möchte.
alls es zu einer 7. überarbeiteten Auflage des Buches einmal kommen
sollte, würde ich mir im Kapitel Quartär noch eine moderne,
stratigraphische Gliederung des Spätglazials und Holozäns für
Baden-Württemberg wünschen, um etwas über die Zeit bspw. der Jüngeren
Dryas oder des Atlantikums im Südwesten zu erfahren.
Besonders positiv hervorzuheben ist das Kap. 5 Geologie und Mensch, in
dem es neben dem Einfluss des Menschen auf die Morphologie und
Geologie v.a. auch um die Nutzung geologischer Ressourcen wie
Rohstoffe, Grundwasser oder Geothermie geht. Ergänzt wird das ganze
Kapitel noch durch die Georisiken wie Erdbeben oder
Massenbewegungen. Umfassend und detailliert wird hier der
Kontaktbereich Menschen und sein geologisches Umfeld dargestellt.
Somit erscheint jetzt die 6. Auflage in einer modernen,
zukunftsorientierten und auch zukunftsfähigen Form, die auch in den
nächsten Jahren ihre hart bedrängte Position als Fachbuch auf Deutsch
neben den wissenschaftlichen, meist englischsprachigen
Veröffentlichungen in Fachzeitschriften stets behaupten wird können.
Als Dozierender an einer bayerischen Universität blicke ich auch etwas
mit Neid auf das Werk, denn etwas Vergleichbares gibt es für Bayern
nicht. Die Werke zur Geologie von Bayern stammen alle aus dem letzten
Jahrtausend und ein neues, dem Stand der Forschung und den modernen,
wissenschaftlichen Standards entsprechendes Werk zur Geologie von
Bayern wäre nicht nur wünschenswert, sondern mehr als
erforderlich. Bücher wie „Bau und Werden der Allgäuer Landschaft“
(Scholz 2016), „Wetzstein, Erz und Kohle“ (Scholz 2023) oder die Reihe
der „Wanderungen in die Erdgeschichte“ sind zwar Lichtblicke, decken
inhaltlich aber nur das Allgäu bzw. kleine Teilregionen von Bayern
ab. Hier vermisst man schmerzlich eine moderne Darstellung der
gesamten „Geologie von Bayern.“
Dr. Bernhard Lempe (TUM)