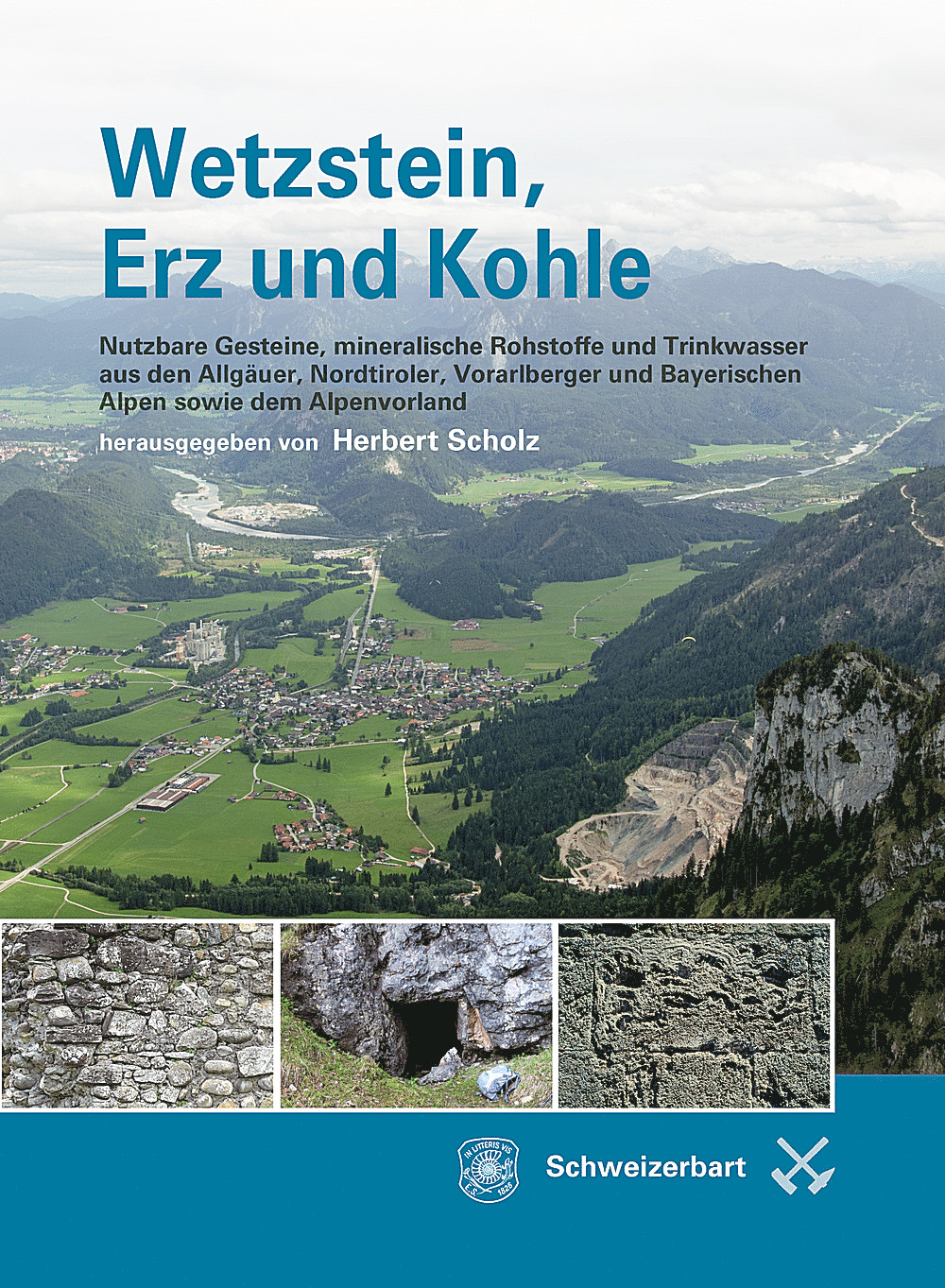Einer der wohl größten Kenner der Allgäuer Geologie,
Prof. Herbert Scholz, Olching, legt als Herausgeber seines neuesten
Buches »Wetzstein, Erz und Kohle« ein umfassendes deutschsprachiges
Werk vor, das weit mehr beinhaltet als die im Untertitel angeführten
»nutzbaren Gesteine, mineralischen Rohstoffe und Trinkwasser«.
Nicht weniger als 22 namhafte Autoren trugen mit ihrem
Spezialwissen zu diesem umfangreichen Buch bei, das auf fast 400
großzügig bebilderten DIN-A4-Seiten die nutzbaren Gesteine des
nördlichen Alpenraums behandelt. Heutzutage ein deutschsprachiges Werk
dieses Umfangs bei einem namhaften Verlag herauszugeben, zeigt, dass
dabei der Wunsch nach Wissensvermittlung vor wirtschaftlichen
Interessen stand.
Neben einer umfangreichen Einführung zur Geologie des beschriebenen
Raums werden fünf Großgruppen an Rohstoffen definiert: »Baustoffe«,
»Mineralische Rohstoffe und Nutzsteine,« »Brennbare Steine«,
»Erzbergbau und Eisenhütten«, »Grundwasser«.
Wer aber nun vermutet, dass es sich um eine schwer zu verstehende,
geologische Rohstoff-Beschreibung handelt, der wird schon beim Blick
auf das Inhaltsverzeichnis überrascht. Denn bereits hier wird
deutlich, wie sehr die anthropogene Entwicklung des nördlichen
Alpenraums auf geologischen Gegebenheiten beruht und welche immense
Bedeutung lokale Rohstoffe hatten und zum Teil auch heute noch
haben.
Der überragende Informationswert dieses Buches liegt in der
Verknüpfung der Themen Rohstoff, lokale Geschichte, Technik und dem
dazugehörigen geologischen Hintergrund. Sowird zum Beispiel im Kapitel
4 »Brennbare Steine« nicht nur auf die Vorkommen von Kohle, Öl und Gas
eingegangen, sondern diese Thematik in 6 Einzelthemen mit 51
Abschnitten gegliedert und umfassend abgehandelt. Neben vielen anderen
Punkten geht es hier z. B. um die Entstehung der Moore und den
Torfabbau, die Schieferkohle-Wälder, die kulturelle Verwendung von
Gagat, die Steinölgewinnung und dessen Verwendung bis hin zur
Tiefbohr- und Fördertechnik von Öl und Gas inkl. deren Techniken zur
Auffindung. Hier wurde endlich einmal zusammengefasst, was bisher
zeitraubende Recherche erforderte. Wer dennoch mehr Informationen
sucht, findet hinter jedem Kapitel eine umfangreiche Liste
weiterführender Literatur.
Somit bietet das Buch nicht nur dem geologisch Interessierten
wertvolle Informationen, sondern ebenso demjenigen, der seine
Kenntnisse an Archäologie, Paläontologie, Technik und
Technikgeschichte oder regionaler Geschichte erweitern oder
vervollkommnen will. Die Ausführungen im Kapitel 3 über
Steinzeit-Werkstoffe, Wetzsteine, Töpferei, Glashüttenwesen und
Flussgold zeigen dies exemplarisch. Die Beschreibungen historischer
Lager- und Betriebsstätten werden Heimatkundler und an lokaler
Geschichte Interessierte begeistern. Natürlich werden auch
paläontologische Details, die mitunter für die Entstehung dieser
Rohstoffe von Bedeutung sind, ausführlich behandelt, so z. B. im
Kapitel 2 »Baustoffe« bei der Entstehung der »Kalk-Tuffe«. Gleiches
gilt für die »brennbaren Steine« und »Wetzsteine«, aber
selbstverständlich wird auch bei den »eiszeitlichen Kiesen« auf deren
Fossilgehalt eingegangen.
Das umfangreiche Kapitel Nr. 5 »Erzbergbau« ist eine aktuelle und
für jedermann verständliche Abhandlung, die den Bereich der
Rohstoffgewinnung im Voralpenraum beleuchtet - ein Fakt, der heute bei
vielen längst aus dem Gedächtnis entschwunden ist. Aktuelle und
historische Techniken und deren chemische Hintergründe sind, wie im
gesamten Buch, nahtlos, verständlich und gut illustriert
eingebunden.
Mit dem Kapitel 6, dem »unterirdischen Wasser«, hingegen wird ein
brandaktuelles Thema behandelt; auch hier, wie in jedem Kapitel,
umfassend und gut verständlich: Von der Suche bis zum Schutz dieses
kostenbaren Rohstoffes, von überholtem Irrglauben bis zu den
geologischen Grundlagen der Grundwasserführung.
Für jeden, der sich in eines der behandelten Themen grundlegend
einarbeiten will oder eine kompakte Zusammenfassung sucht, ohne dabei
begleitende, aber wichtige Themen außer Acht zu lassen, ist dieses
Werk ein »Muss«, auch deshalb, weil es übersichtlich gegliedert und
gut verständlich geschrieben ist. Die wenigen kurzen, aber kritischen
Anmerkungen des Verfassers z. B. zum Thema Grundwassersuche oder zur
»behördlichen Begrünungswut« von Geotopen sind richtig und wichtig und
führen hoffentlich zu mehr Einsicht und besserem Umgang mit
geologischen Sachverhalten im öffentlichen Bewusstsein.
Ein umfangsreiches Stichwortverzeichnis erleichtert das Auffinden
jeglicher Sachinhalte. Zusammen mit dem Inhaltsverzeichnis und den
Literaturhinweisen ist das Buch sowohl ein umfangreiches
historisch-geologisches Nachschlagewerk als auch ein grundlegendes
Lehrbuch erster Güte.
In Anbetracht des enormen Umfangs ist der Preis von etwas weniger
als 50 € mehr als angemessen. Ermöglicht haben dieses günstige Angebot
zahlreiche, zu Beginn des Buches aufgeführte Sponsoren. Deswegen gibt
es im Buch auch einige wenige Werbeanzeigen, die aber in der Summe nur
2 Seiten im Text sowie die beiden Innenseiten des Einbands
umfassen.
Durch die allumfassende Darstellung eines großen Themenkomplexes
ist dieses Werk für eine breite Interessengemeinschaft von großer
Relevanz und absolut empfehlenswert. Möge das Buch weite und
zahlreiche Verbreitung finden und in vielen weiteren Auflagen eine
große Leserschaft begeistern.
Uwe Ryck