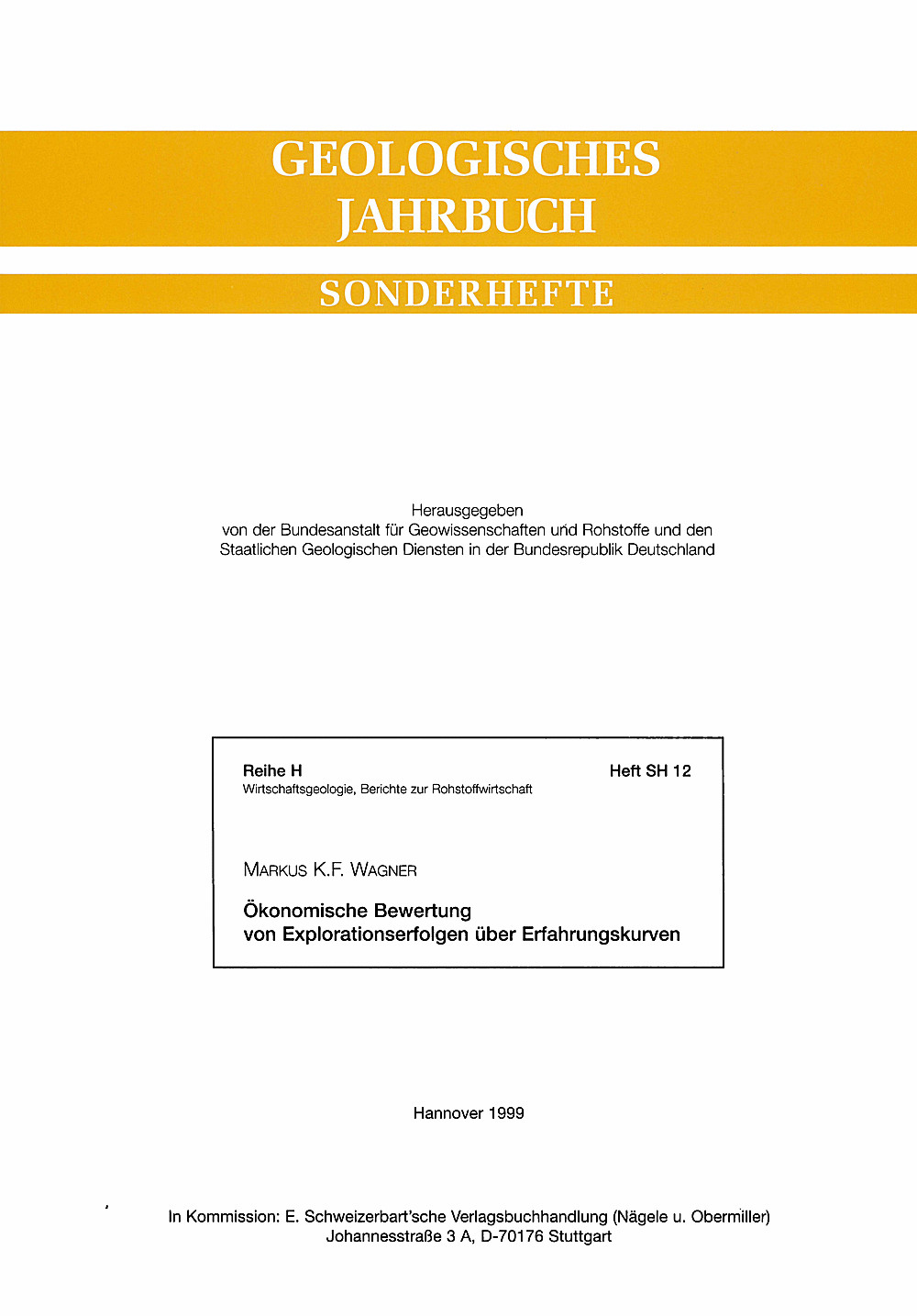Inhaltsbeschreibung nach oben ↑
Noch vor einigen Jahren beherrschte die Sorge um die Sicherheit einer
langfristigen ausreichenden Versorgung mit mineralischen Rohstoffen die
Rohstoffpolitik der Industrieländer. Inzwischen ist die Frage der
Versorgungssicherheit angesichts eines gegenwärtig funktionsfähigen
Welthandels und in überschaubarer Zeit nicht erkennbarer Engpässe in den
Hintergrund getreten. Im Vordergrund stehen jetzt Probleme aus dem
Spannungsfeld Umwelt und Rohstoffgewinnung.
Die vorliegende Erfassung des Energiebedarfs und der Stoffflüsse bei der Gewinnung mineralischer Rohstoffe mit den wichtigsten Einsatz- und Reststoffmengen bei Abbau der Lagerstätten, Aufbereitung und Verrbeitung der Erze/Minerale (Verhüttung) schafft eine Basis für grundlegende Die konventionelle Bewertung von Bergbauprojekten auf der Grundlage von Wirtschaftlichkeitsrechnungen geht üblicherweise von den vor Beginn des Abbaus nachgewiesenen Vorräten aus. Die Auswertung der Entwicklung der Vorratszahlen zahlreicher Betriebe führt jedoch zu dem Ergebnis, daß durch Exploration im Bereich bekannter Lagerstätten erfahrungsgemäß weitere Vorräte hinzugefunden werden, was sich in einer beträchtlichen Erhöhung des Lagerstättenpotentials niederschlagen kann.
Anhand der fortlaufenden Produktions- und Vorratsangaben ausgewählter Metallerzgruben wird überprüft, inwieweit sich der Explorationserfolg als Funktion der Zeit darstellen läßt und ob, nach vorherigem Erkundungsgrad und Vererzungstyp getrennt, charakteristische Entwicklungen erkennbar sind. Dieser für das wirtschaftliche Gesamtergebnis wichtige Aspekt einer dynamischen Betrachtung der Vorratssituation von Lagerstätten der Metallrohstoffe, wird systematisch in die Bewertung mit einbezogen. Dazu wird das in der Praxis der strategischen Planung und Unternehmensführung bewährte Konzept der Erfahrungs- und Wachstumskurven aufgegriffen, womit der betriebliche Erfahrungszuwachs und der damit einhergehende Rückgang im Faktoreinsatz abgebildet werden kann.
In einem einführenden Teil werden die angewandten Verfahren der Analyse und Prognose abgeleitet und erläutert. Ursachen und Hintergründe der Erfahrungs- und Wachstumskurve werden mit einschlägigen Fallbeispielen aus der Rohstoffexploration und -wirtschaft illustriert, wobei drei Typen von Buntmetallvererzungen, nämlich Blei-Zink-Vererzungen des Mississippi Valley Typs, porphyrische Kupferlagerstätten sowie vulkanogene Massivsulfidlagerstätten näher betrachtet werden. Die jeweiligen geowissenschaftlichen Lagerstättenmodelle werden um ökonomische und explorationstechnische Aspekte erweitert.
Die Untersuchungen gestatten eine Interpretation von Explorationserfolgen als Ergebnisse von Lerneffekten und Erfahrungsgewinnen. Deren Einfluß kann mit Hilfe des Zufunds quantitativ dargestellt werden. Abhängig vom betrachteten Lagerstättentyp zeichnen sich unterschiedliche Entwicklungen ab. Die hierfür maßgeblichen Ursachen sind in der charakteristischen Lagerstättenarchitektur der Untersuchungsobjekte zu suchen. Von dem sprunghaften Verlauf der Erfahrungskurve der Exploration im Fall der porphyrischen Lagerstätten ausgehend, zeichnet sich ein Trend über die S-Kurve der Explorationserfolge in MVT-Lagerstätten hin zu dem nahezu linear-proportionalen Verlauf der Wachstumskurve bei der Erkundung von Massivsulfiderzkörpern ab. Je deutlicher der Kontrast zwischen Lagerstätte und Nebengestein ausgeprägt ist, desto stärker tendiert die Kurve zu einem linearen Verlauf. Anhand der typspezifischen Verlaufsmuster können divergierende Planungsvorgaben abgeleitet werden, die als Sollgrößen den Erwartungshorizont für künftige Explorationsvorhaben markieren.
Eine entscheidende Rolle für ein sprunghaftes Anwachsen der Zufund- oder Fündigkeitsrate kommt dem gemeinhin als Paradigmawechsel bezeichneten Phänomen zu. Die Neuinterpretation der geologischen Verhältnisse führt zur Entdeckung neuer, bis dahin unbekannter Proximitätsindikatoren und damit zu einer Revision der Explorationsstrategie. Die Auswirkungen in Form eines wachsenden Explorationserfolges sind dabei sowohl auf regionaler Ebene als auch bei der Betrachtung des Einzelprojekts nachvollziehbar.
Eine Betrachtung der Chronik von "off-site"-Explorationsprojekten vor der Investitionsentscheidung über Erfahrungskurvenmodelle ermöglicht eine finanzmathematische Bewertung. Auf der Grundlage des wachsenden Erkundungsgrades und der statistischen Erfolgswahrscheinlichkeit läßt sich der notwendige Explorationsaufwand als Funktion des Zeitpunktes einer Entdeckung ermitteln. Unabhängig von den untersuchten Lagerstättentypen zeichnet sich ab, daß die " on-site" -Exploration während der Laufzeit eines Rohstoffprojektes | spätestens dann neue Ansätze zur Erhöhung der Vorräte und erfolgreichen Fortsetzung des Projektes entwickelt haben muß, wenn die initialen Vorräte zu zwei Dritteln erschöpft sind. Der Frage, wo das wirtschaftliche Optimum der Dauer für einen Abbau von La gerstättenvorräten unter Berücksichtigung der Erfahrungskurve liegt, wird mit einem im Rahmen dieser Untersuchungen entwickelten und in ein DV-System implementierten Planungsmodell nachgegangen. Dieses gestattet die iterative Ermittlung der 1 wirtschaftlich vorteilhaftesten Lebensdauer eines Modellbergwerks bei dynamischer Vorratsentwicklung. Das hierfür verwendete Beurteilungskriterium ist die aus der Kapital wertfunktion ableitbare und im anglo-amerikanischen Raum verbreitete Kennziffer des Present value ratio.
Die abschließende Adaptierung der Wachstumskurvenmodelle in einer Modellrechnung ergibt, daß die auf Basis der Anfangsreserven bestimmte optimale Projektlaufzeit ausreichend f ist, um die vorteilhafteste Lebensdauer unter Berücksichtigung des Zufunds zu erreichen. Eine Streckung der ursprünglich geplanten Lebensdauer wird demnach nicht empfohlen. Vielmehr legt dieses Ergebnis nahe, in Antizipation des Zufunds das Projekt mit einer höhe ren Kapazität und damit einer kürzeren Lebensdauer zu starten. Verschiedene Beispiele zeigen, daß das Konzept der Wachstumskurve bereits Einzug in die ', Bergbaupraxis hält. Zumindest was gut erkundete Reviere mit einer langen Bergbautradition betrifft, werden schon jetzt extrapolierte Zufundraten bei der Planung berücksichtigt. Doch auch bei Projekten auf unverritzter Lagerstätte ermöglicht der hier vorgeschlagene Ansatz, den Erwartungshorizont für den Explorationserfolg über die Lebensdauer des Betriebes ~ abzuschätzen. Resümierend sind Anwendungsmöglichkeiten einer Bewertung von Explorationserfolgen über Erfahrungskurven denkbar im Rahmen der Projektfinanzierung oder einer Akquisition sowie im Rahmen des Monitorings laufender Betriebe und Bergbaureviere.
Die Anwendung der nach Lagerstättentyp spezifizierten Wachstumskurven-Modelle als zusätzlicher Indikator für die Kapazitätsplanung zukünftiger Bergwerksprojekte liefert einen neuartigen Ansatz, die Kriterien des ökonomischen Prinzips im Bereich der wirtschaftlichen Bewertung von Lagerstätten auf geowissenschaftlicher Basis zu objektivieren.
Die vorliegende Erfassung des Energiebedarfs und der Stoffflüsse bei der Gewinnung mineralischer Rohstoffe mit den wichtigsten Einsatz- und Reststoffmengen bei Abbau der Lagerstätten, Aufbereitung und Verrbeitung der Erze/Minerale (Verhüttung) schafft eine Basis für grundlegende Die konventionelle Bewertung von Bergbauprojekten auf der Grundlage von Wirtschaftlichkeitsrechnungen geht üblicherweise von den vor Beginn des Abbaus nachgewiesenen Vorräten aus. Die Auswertung der Entwicklung der Vorratszahlen zahlreicher Betriebe führt jedoch zu dem Ergebnis, daß durch Exploration im Bereich bekannter Lagerstätten erfahrungsgemäß weitere Vorräte hinzugefunden werden, was sich in einer beträchtlichen Erhöhung des Lagerstättenpotentials niederschlagen kann.
Anhand der fortlaufenden Produktions- und Vorratsangaben ausgewählter Metallerzgruben wird überprüft, inwieweit sich der Explorationserfolg als Funktion der Zeit darstellen läßt und ob, nach vorherigem Erkundungsgrad und Vererzungstyp getrennt, charakteristische Entwicklungen erkennbar sind. Dieser für das wirtschaftliche Gesamtergebnis wichtige Aspekt einer dynamischen Betrachtung der Vorratssituation von Lagerstätten der Metallrohstoffe, wird systematisch in die Bewertung mit einbezogen. Dazu wird das in der Praxis der strategischen Planung und Unternehmensführung bewährte Konzept der Erfahrungs- und Wachstumskurven aufgegriffen, womit der betriebliche Erfahrungszuwachs und der damit einhergehende Rückgang im Faktoreinsatz abgebildet werden kann.
In einem einführenden Teil werden die angewandten Verfahren der Analyse und Prognose abgeleitet und erläutert. Ursachen und Hintergründe der Erfahrungs- und Wachstumskurve werden mit einschlägigen Fallbeispielen aus der Rohstoffexploration und -wirtschaft illustriert, wobei drei Typen von Buntmetallvererzungen, nämlich Blei-Zink-Vererzungen des Mississippi Valley Typs, porphyrische Kupferlagerstätten sowie vulkanogene Massivsulfidlagerstätten näher betrachtet werden. Die jeweiligen geowissenschaftlichen Lagerstättenmodelle werden um ökonomische und explorationstechnische Aspekte erweitert.
Die Untersuchungen gestatten eine Interpretation von Explorationserfolgen als Ergebnisse von Lerneffekten und Erfahrungsgewinnen. Deren Einfluß kann mit Hilfe des Zufunds quantitativ dargestellt werden. Abhängig vom betrachteten Lagerstättentyp zeichnen sich unterschiedliche Entwicklungen ab. Die hierfür maßgeblichen Ursachen sind in der charakteristischen Lagerstättenarchitektur der Untersuchungsobjekte zu suchen. Von dem sprunghaften Verlauf der Erfahrungskurve der Exploration im Fall der porphyrischen Lagerstätten ausgehend, zeichnet sich ein Trend über die S-Kurve der Explorationserfolge in MVT-Lagerstätten hin zu dem nahezu linear-proportionalen Verlauf der Wachstumskurve bei der Erkundung von Massivsulfiderzkörpern ab. Je deutlicher der Kontrast zwischen Lagerstätte und Nebengestein ausgeprägt ist, desto stärker tendiert die Kurve zu einem linearen Verlauf. Anhand der typspezifischen Verlaufsmuster können divergierende Planungsvorgaben abgeleitet werden, die als Sollgrößen den Erwartungshorizont für künftige Explorationsvorhaben markieren.
Eine entscheidende Rolle für ein sprunghaftes Anwachsen der Zufund- oder Fündigkeitsrate kommt dem gemeinhin als Paradigmawechsel bezeichneten Phänomen zu. Die Neuinterpretation der geologischen Verhältnisse führt zur Entdeckung neuer, bis dahin unbekannter Proximitätsindikatoren und damit zu einer Revision der Explorationsstrategie. Die Auswirkungen in Form eines wachsenden Explorationserfolges sind dabei sowohl auf regionaler Ebene als auch bei der Betrachtung des Einzelprojekts nachvollziehbar.
Eine Betrachtung der Chronik von "off-site"-Explorationsprojekten vor der Investitionsentscheidung über Erfahrungskurvenmodelle ermöglicht eine finanzmathematische Bewertung. Auf der Grundlage des wachsenden Erkundungsgrades und der statistischen Erfolgswahrscheinlichkeit läßt sich der notwendige Explorationsaufwand als Funktion des Zeitpunktes einer Entdeckung ermitteln. Unabhängig von den untersuchten Lagerstättentypen zeichnet sich ab, daß die " on-site" -Exploration während der Laufzeit eines Rohstoffprojektes | spätestens dann neue Ansätze zur Erhöhung der Vorräte und erfolgreichen Fortsetzung des Projektes entwickelt haben muß, wenn die initialen Vorräte zu zwei Dritteln erschöpft sind. Der Frage, wo das wirtschaftliche Optimum der Dauer für einen Abbau von La gerstättenvorräten unter Berücksichtigung der Erfahrungskurve liegt, wird mit einem im Rahmen dieser Untersuchungen entwickelten und in ein DV-System implementierten Planungsmodell nachgegangen. Dieses gestattet die iterative Ermittlung der 1 wirtschaftlich vorteilhaftesten Lebensdauer eines Modellbergwerks bei dynamischer Vorratsentwicklung. Das hierfür verwendete Beurteilungskriterium ist die aus der Kapital wertfunktion ableitbare und im anglo-amerikanischen Raum verbreitete Kennziffer des Present value ratio.
Die abschließende Adaptierung der Wachstumskurvenmodelle in einer Modellrechnung ergibt, daß die auf Basis der Anfangsreserven bestimmte optimale Projektlaufzeit ausreichend f ist, um die vorteilhafteste Lebensdauer unter Berücksichtigung des Zufunds zu erreichen. Eine Streckung der ursprünglich geplanten Lebensdauer wird demnach nicht empfohlen. Vielmehr legt dieses Ergebnis nahe, in Antizipation des Zufunds das Projekt mit einer höhe ren Kapazität und damit einer kürzeren Lebensdauer zu starten. Verschiedene Beispiele zeigen, daß das Konzept der Wachstumskurve bereits Einzug in die ', Bergbaupraxis hält. Zumindest was gut erkundete Reviere mit einer langen Bergbautradition betrifft, werden schon jetzt extrapolierte Zufundraten bei der Planung berücksichtigt. Doch auch bei Projekten auf unverritzter Lagerstätte ermöglicht der hier vorgeschlagene Ansatz, den Erwartungshorizont für den Explorationserfolg über die Lebensdauer des Betriebes ~ abzuschätzen. Resümierend sind Anwendungsmöglichkeiten einer Bewertung von Explorationserfolgen über Erfahrungskurven denkbar im Rahmen der Projektfinanzierung oder einer Akquisition sowie im Rahmen des Monitorings laufender Betriebe und Bergbaureviere.
Die Anwendung der nach Lagerstättentyp spezifizierten Wachstumskurven-Modelle als zusätzlicher Indikator für die Kapazitätsplanung zukünftiger Bergwerksprojekte liefert einen neuartigen Ansatz, die Kriterien des ökonomischen Prinzips im Bereich der wirtschaftlichen Bewertung von Lagerstätten auf geowissenschaftlicher Basis zu objektivieren.