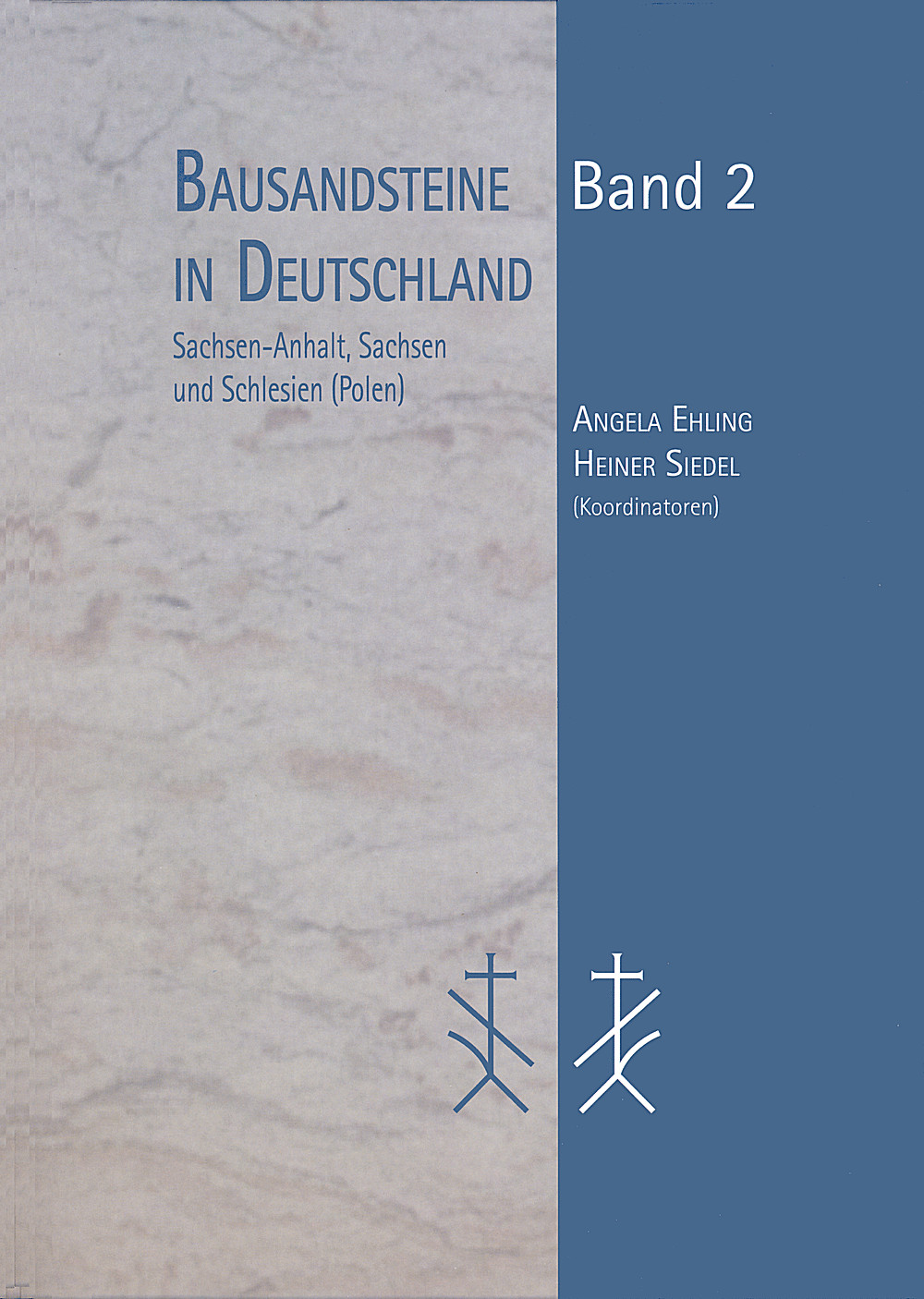Nach dem 2009 erschienenen ersten Band Grundlagen und Überblick
(Zbl. Geol. Paläont. Teil II, 2010 (3-4), Ref. 858) erschien nun der
zweite, vollständig farbig illustrierte Band über die Bausandsteine in
Deutschland. Die hier vorgestellten aktuellen und historischen
Bausandsteine stammen ausschließlich aus den drei Regionen
Sachsen-Anhalt, Sachsen und aufgrund ihrer weiten Verbreitung in
deutschen Bauwerken grenzüberschreitend aus Schlesien.
Alle aus diesen Regionen wichtigen Bausandsteine sind vom
stratigraphisch ältesten bis zum stratigraphisch jüngsten
Sandsteinvorkommen umfassend geowissenschaftlich und bautechnologisch
beschrieben. I. Sachsen-Anhalt (A. EHLING, B.-C. EHLING,
E. MODEL & M. WEHRY): 1. Gommern-Quarzit; 2. Magdeburger Grauwacke;
3. Oberkarbon-Sandsteine (Gorentzen-, Rothenburger, Siebigeröder,
Kyffhäuser-, Wettiner Sandstein); 4. Rotliegend-Sandsteine
(Saale-Senke und Meisdorfer Becken: Permo, Hornburger, Blankenheimer,
Rundkörniger, Meisdorfer Sandstein; Flechtinger Bausandstein:
Alvenslebener und Bebertal-Sandstein); 5. Buntsandsteine (Unterer
Buntsandstein: Zeitzer Sandstein – Droyßiger, Haynsburger,
Staudenhainer, Pölziger Sandstein – sowie Wangener und Allstedter
Sandstein; Mittlerer Buntsandstein: Nebraer Sandstein sowie Wörmlitzer
und Bernburger Sandstein; 6. Rhät-Sandstein (Magdeburger, Ummendorfer,
Seehäuser, Wormsdorfer und Allertal-Sandstein); 7. Kreidesandsteine
(Halberstädter Sandstein, Teufelsmauer-Quarzit, Lehof- Sandstein);
II. Sachsen (H. SIEDEL, J. GÖTZE, K. KLEEBERG & G. PALME): 1.
Karbon (Zwickauer Kohlesandstein, Planitzer Sandstein); 2. Trias
(Buntsandstein – aus dem Mügelner Becken, in der Bornaer Mulde und im
östlichen Ausläufer der Zeitz-Schöllner Mulde); 3. Kreide (Cenomanium
südlich Dresden – Welschhufesandstein und Pennricher Sandstein – und
im Tharandter Wald – Grillenburger Sandstein und Sandstein von
Niederschöna; Turonium und Coniacium des Elbsandsteingebirges
(Sächsische Schweiz) – Cottaer Sandstein, Kirchleite-Sandstein,
Reinhardtsdorfer Sandstein, Teichstein-Sandstein und Postaer
Sandstein; Turonium und Coniacium des Zittauer Gebirges –
Waltersdorfer Sandstein, Jonsdorf-Sandstein und Hochwald-Sandstein);
III. Schlesien (A. EHLING): 1. Turonium-Sandsteine im
Nordsudetischen Becken: Plagwitzer Sandstein; 2. Coniacium-Sandsteine
im Nordsudetischen Becken: Rackwitzer Sandstein – Rackwitzer,
Warthauer, Sirgwitzer, Deutmannsdorfer, Hockenauer, Neudorfer,
Bunzlauer, Skala, Zelizower Sandstein; 3. Mittel-Turonium-Sandsteine
im Heuscheuergebirge (Wünschelburger Sandstein – Radkow-, Albendorfer,
Wallisfurther, Oberlangenauer, Dlugopole Sandstein); 4. Ober-Turonium-
Sandsteine im Heuscheuergebirge (Heuscheuer-Sandstein –
Friedersdorfer, Cudowaer, Tscherbeneyer, Szczytna-Zamek, Polanica Zdoi
Sandstein).
Der erste Hauptteil des Buches Bausandsteine in Sachsen-Anhalt
informiert in seinem Vorwort über die Herkunft der vorgestellten
Informationen und des bereitgestellten Untersuchungsmaterials. Danach
folgt eine ausführliche Einführung in die Themen: Geographie,
Geologie, Abbau und Verwendung der Sandsteine (in der Jungsteinzeit,
Karolingischen Zeit, Ottonischen Zeit, Romanik, Gotik, Renaissance und
Barock, im Klassizismus und in der Romantik sowie im
Industriezeitalter). Danach folgen die Beschreibungen der
verschiedenen Sandsteinvorkommen und das zugehörige
Literaturverzeichnis. Jeder Bausandstein ist nach dem gleichen Schema
präsentiert: Allgemeines, andere Bezeichnungen; Geologie
(Stratigraphie und Alter, Vorkommen, Genese); Petrographie
(makroskopische und mikroskopische Charakterisierung – Textur,
Struktur, Komponenten, Bindung, Porenraum); Geochemie;
gesteinstechnische Daten; Verwitterungsverhalten; ähnliche Sandsteine;
Abbau; Verwendung; Fototafel (bestehend aus makroskopischen
Gesteinsfotos an typischen Bauwerken und Dünnschlifffotos); Lagekarte;
verwendete und weiterführende Literaturzitate.
Der zweite Teil über die Bausandsteine in Sachsen ist ähnlich
aufgebaut wie der erste. Anstelle detaillierter
Dünnschliffbeschreibungen – wie wir sie im ersten und dritten Teil fi
nden – enthält er nur eine tabellarische mikroskopische
Charakterisierung, aber zusätzlich sind neben den normalen
polarisationsmikroskopischen Aufnahmen auch Dünnschlifffotos mit
Kathodolumineszenzanregung, rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen,
Korngrößenverteilungskurven sowie Quecksilber-porosimetrische
Verteilungsdiagramme darge stellt und mehr bautechnische Werte
tabelliert.
Der dritte und letzte Teil über die Bausandsteine in Schlesien gibt in
gekürzter Form die Ergebnisse der Doktorarbeit und weitere
Forschungsergebnisse der Herausgeberin ANGELA EHLING wieder. Er ist
genauso aufgebaut wie der erste Teil. Insgesamt stammen die
aufgelisteten, petrographisch-geochemischen und bautechnischen Daten
entweder aus bereits veröffentlichten Arbeiten, aus unveröffentlichten
Berichten, Diplom- und Doktorarbeiten oder aus neuen analytischen
Untersuchungen. Während von den aktuell eingesetzten Sandsteinen
durchweg die wichtigsten bautechnischen Kennwerte vorliegen, fehlen
aus Kostengründen von einigen historischen Vorkommen entsprechende
Daten.
Das Werk ist übersichtlich aufgebaut, die Texte gut verständlich
geschrieben, so dass sie auch für Nicht-Geowissenschaftler geeignet
sind. Die einzelnen Bundesländer und das Kapitel Methodik/Abkürzungen
sind jeweils am oberen Seitenrand farblich voneinander abgesetzt, was
die Handhabung sehr erleichtert – Sachsen-Anhalt: braun; Sachsen:
gelb; Schlesien: olivgrün; Methodik und Abkürzungen: grau. Ebenso
angenehm sind die briefmarkengroßen Begleitfotos am linken Rand der
Tafelerklärungen. Die Abbildungen – Farbfotos von Dünnschliffen,
Gebäuden, Gebäudeteilen und Denkmälern, SW-Fotos von REM-Aufnahmen
sowie farbige geologische Karten, stratigraphische Tabellen,
geologische Profi le und Lageskizzen der Sandsteinvorkommen – sind
durchweg von guter Qualität. Das als Nachschlagewerk konzipierte Buch
hat eine hervorragende Bindung, die auch einem häufi gen Gebrauch
standhält.
Bei der eingehenden Lektüre der einzelnen Kapitel und Unterkapitel
fallen zwar einige Unstimmigkeiten auf, wie z. B. hinsichtlich der
zeitlichen und stratigraphischen Zuordnung manches Sandsteins, der
Verwendung einzelner Begriffe und der Beschreibung der einzelnen
Bausteine – einschließlich der Tafeln bzw. der angeglichenen
Abbildungsseiten –, doch ist dies sicherlich den verschiedenen
Bearbeitern und den aus der Literatur entnommenen Tabellen und Profi
len zuzuschreiben. Hier wäre eine bessere Angleichung der einzelnen
Teile durch die Koordinatoren bzw. die Redaktion wünschenswert
gewesen. Das sollte man in den noch vier folgenden Bänden unbedingt
beachten.
Genau wie der erste Band der geplanten sechsteiligen Buchreihe eignet
sich dieses Werk mit seinen vielen bekannten und weniger bekannten
regionalen Bausandsteinen aus den drei Regionen Sachsen-Anhalt,
Sachsen und Schlesien für jeden Anwender in der Baudenkmalpfl ege, für
Archäologen, Historiker, Architekten, Bauingenieure und für jeden mit
Bausteinen befassten Geologen und Mineralogen und manchen
interessierten Stadtführer und Stadtplaner. Das Buch gehört ebenso in
jede Universitätsbibliothek und Fachbücherei des Bauingenieurwesens,
der Geowissenschaften, der Architektur, der Archäologie und der
verschiedenen Geologischen Landesämter und Denkmalbehörden.
CORNELIA SCHMITT-RIEGRAF, Münster i. Westf.
Zentralblatt für Geologie und Paläontologie Teil II, Jg. 2012, Heft 3/4