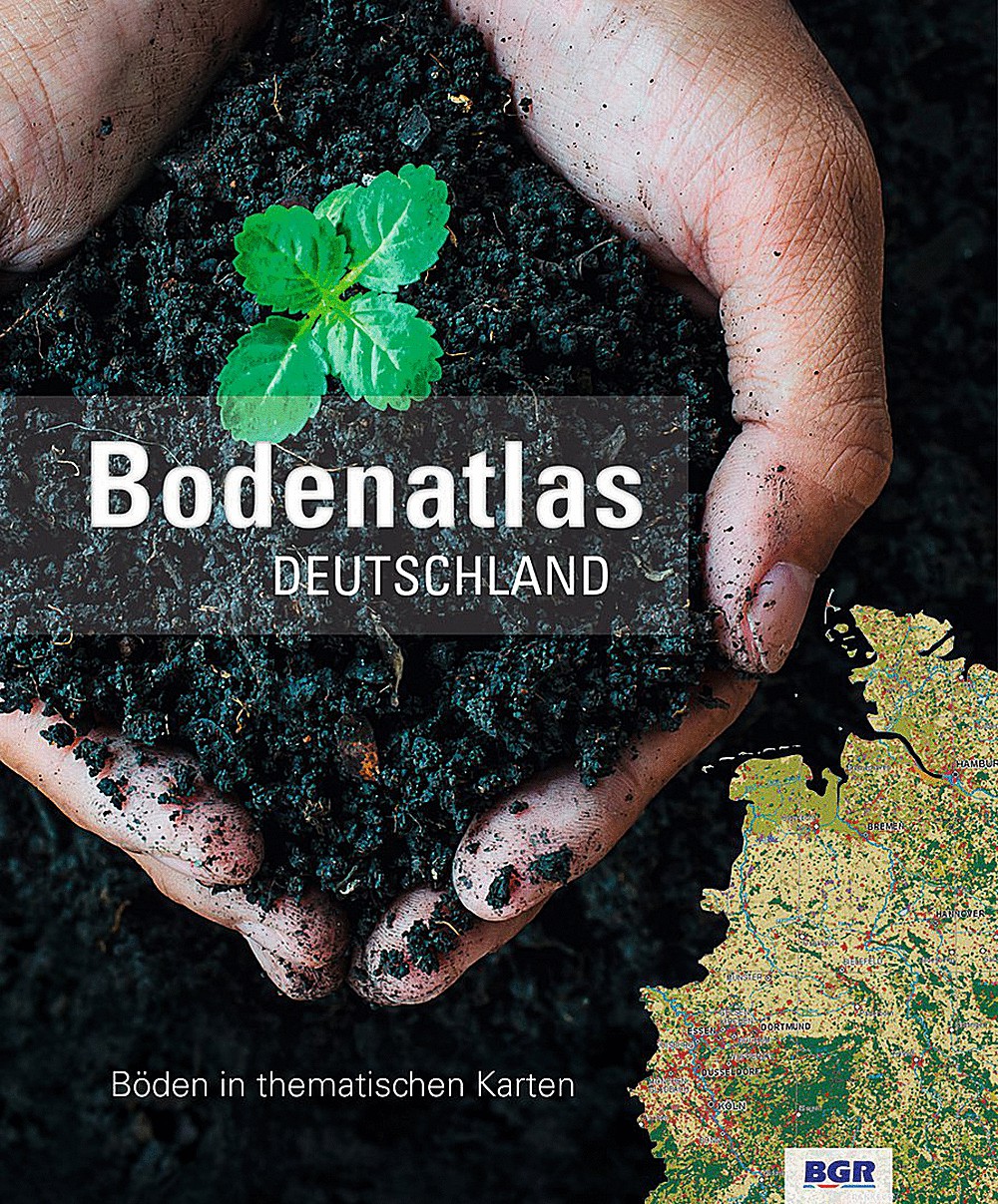Mit dem „Bodenatlas Deutschland“ liegt ein gewichtiges und
gleichzeitig sehr wichtiges Buch vor, das eine interessante Lücke
bezüglich bodenkundlichem Wissen füllt: es beinhaltet Texte und vor
allem Karten, Fotos und Grafiken, welche die Komplexität der
bodenkundlichen Grundinformationen verbinden mit deutschlandweiten
Fachkarten und Hinweisen zum Bodenschutz, und das alles in sehr gutem
Layout und hervorragender Druckqualität. Das macht das Lesen zum
Genuss, da auch das verwendete Papiermaterial des Buches taktil ein
gutes „Lesegefühl“ vermittelt. Das betrifft auch so kleine
„Nebensächlichkeiten“, wie das in den Buchdeckel tiefer eingeprägte
Wort „Bodenatlas“. So kann der interessierte Leser mit „allen Sinnen
eintauchen“ in die komplexe Welt der Böden, ihre Bedeutung verstehen,
die Mühen der kartografischen Darstellung nachvollziehen und sich klar
werden, wie diese dünne Haus der Erde, die lebenswichtig für uns alle
ist, gerade auch durch unsere Nutzung gefährdet ist.
Der Bodenatlas Deutschland wird angekündigt durch ein Grußwort des
Bundesministers für Wirtschaft und Energie, Minister Gabriel, und den
Präsidenten des Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe,
Prof. Kümpel. Beide Herren betonen die übergreifende Bedeutung des
Mediums Boden und die Bedeutung, dass ein breites Wissen über den
Boden die Voraussetzung für eine nachhaltige Nutzung und den Schutz
darstellt.
Der Bodenatlas umfasst sieben Fachkapitel, die durch einen Anhang mit
Informationen zur verwendeten Literatur, einem Abkürzungsverzeichnis
und einem sehr hilfreichen Glossar ergänzt wird. Enthalten sind auf
den insgesamt 144 Seiten der im A3-Format vorliegenden
Veröffentlichung 48 ganzseitige Fachkarten im Maßstab 1: 3 Mio., 67
Abbildungen und 8 Tabellen sowie sehr viele Fotos. Diese fangen wohl
eher Stimmungen ein, wie das sehr schöne Foto gleich auf der 1. Seite
mit einer gerade dem Boden ent - wachsenden Jungpflanze oder dem
Landschaftsausschnitt aus einer vermutlich mitteldeutschen Region mit
blühenden Rapsfeldern in kleinräumigem Wechsel mit Grünland, als dass
sie auch detaillierte Fachaussagen liefern. Diese Fotos sind sehr gut
gelungen und zeigen die Faszination des Themas, eine Information zum
Aufnahmeort wäre hilfreich gewesen. Das betrifft insbesondre die
ergänzenden Fotos mit Fachbezug, wie z. B. auf Seite 110 eine durch
Winderosion beeinflusste Landschaft, wo mehr Informationen zum Ort
oder den Umständen interessant gewesen wären.
Der Atlas beginnt mit den Kapiteln eins („Boden-multifunktionale
Lebensgrundlage“) und Kapitel zwei („Wie entstehen unserer Böden“) mit
Wissen zum Grundverständnis. Dabei gelingt es den Autoren überwiegend
sehr gut, die komplizierten Zusammenhänge verständlich
darzustellen. In Abbildung 1.1.5. wird erklärt, wieso in Mooren (es
ist hier ein Hochmoor) die Bodenentwicklung abweichend von der in
Mineralböden verläuft. Dabei ist die Begründung über den Grad der
Zersetzung nicht korrekt- je nach Torfbildungen können in sehr großen
Tiefen gering zersetzte Torfe gefunden werden. Bereits im ersten
Kapitel wird erklärt, was Bodenfunktionen sind und wie Karten
entstehen. Diese Unterkapitel erfordern dann schon eine bestimmte
Grundvorbildung. Aber gerade das Subkapitel 1.3. „Böden in Karten“ ist
sehr wichtig, da dieses Thema in den klassischen Bodenkundelehrbüchern
oft zu kurz kommt. Gut erklärt sind die Probleme der Maßstabsebenen
und die Unsicherheiten, die beim Verschnitt verschiedener
Datenqualitäten entstehen.
Im Kapitel zwei werden dann die wesentliche Ausgangskarten
veröffentlicht, die zum Verständnis der Bodenverteilung in Deutschland
wichtig sind: „Ausgangsgestein der Bodenbildung“, „Karte der
geomorphografischen Einheiten“, „Jahresniederschlag“, „Verdunstung“,
„Wasserbilanz“ und „Bodenbedeckung und Landnutzung“. Bei letzterer ist
die Klasse „künstlich angelegte, nicht wirtschaftlich genutzte
Grünflächen“ nicht zu erschießen und erschwert bezüglich der drei
verwendeten Grüntöne dann das Verständnis der Karte.
Im Kapitel drei werden mit den Karten: „Bodenübersichtskarte“,
„Bodengroßlandschaften“, „Bodenarten“, „Gehalt des Oberbodens an
organischer Substanz“ die flächendeckend wichtigen Bodeninformationen
gegeben. Sehr gut werden dabei jeweils erst die Methodik erklärt, so
dass gut nachzuvollziehen ist, welche Daten zur Erstellung der Karten
genutzt wurden; anschließend werden die Karten fachlich interpretiert.
Es wäre sehr hilfreich gewesen, wenn die Karten mit Tabellen der
Verteilung der einzelnen Legendeneinheiten ergänzt worden wären, dies
gilt eigentlich für fast alle Karten. Eventuell wäre sogar eine
Zuordnung zu den Bundesländern durch einen Verschnitt mit den
Verwaltungsgrenzen möglich gewesen, da für viele Fragen, insbesondere
im Bodenschutz vergleichende Aussagen zu den einzelnen Bundesländern
notwendig sind. Die Karte der Gründigkeit des Bodens erschließt sich
von der Methodik her schwer, eher nicht wegen fehlender Erläuterung
sondern eher bezüglich der Frage, wie die physiologische Gründigkeit
in den Auen und Gleyen mit ihrer hohen Jahresdynamik abgebildet werden
kann. Bezüglich der Informationen zu Mooren ist anzumerken, dass beim
Vergleich der Karten 3.2.1 („Bodenart des Oberbodens“; mit der
Legendeneinheit „Moore“) und mit Karte 3.2.2. („Gehalt des Oberbodens
an organischer Substanz“ mit der Legendeneinheit „>30 Masse%“)
offensichtliche Flächenunterschiede vorhanden sind.
Im Kapitel „Wasser und Boden“ (Kapitel 4) wird die Abhängigkeit dieser
beiden Umweltmedien diskutiert; diese Fragestellung ist insbesondere
in Anbetracht der klimabedingten Veränderungen sehr wichtig. Die
Fachkarten informieren über das pflanzenverfügbare Bodenwasser (Karte
4.1.1.), die Ausschöpfungstiefe des Bodenwassers (wobei hier die
Kartenlegende selbst mit „Effektive Durchwurzelungstiefe (dm)“
bezeichnet wurde) und weiteren Themenkarten im Maßstab 1: 1,4 Mio. Die
Textinformationen sind sehr gut geeignet, die Zusammenhänge zwischen
Bodenbildung, Substrateigenschaften und bodenhydrologischen
Eigenschaften zu verstehen.
Kapitel fünf und sechs widmen sich den wichtigsten
Bodengefährdungen. Interessanterweise ist die Versiegelung
(einschließlich Karten) nicht thematisiert. Kapitel fünf beginnt mit
dem Zitat von Gothe „ Es ist nicht genug, zu wissen, man muss auch
anwenden“ und weist damit sehr zielführend auf unsere Verantwortung im
Schutz der Böden hin. Das betrifft insbesondere die in diesem Kapitel
behandelten Schwermetallbelastungen der Böden, die sowohl natürlichen
als auch menschlichen Ursprungs sind. Die Karte zur Bindung von Kupfer
ist allerdings schwer nutzbar, da die Farbabstufungen eine
Unterscheidung der Klassen kaum ermöglichen. Abschließend zu diesem
Thema passt dann die Karte der Austauschhäufigkeit des Bodenwassers in
landwirtschaftlich genutzten Böden sehr gut, weil hier die Verbindung
zu den vorher dargestellten stofflichen Informationen und dem
möglichen Weg von Schadstoffen in das Grundwasser deutlich wird. Auch
hier wird wieder der enge Zusammenhang zu den Bodenbildungen deutlich.
Kapitel sechs widmet sich mit den Gefährdungen „Bodenerosion durch
Wasser und Wind“ sowie der „Verdichtung“ durch Landmaschinen den
unmittelbarsten Gefahren durch die Landwirtschaft. Die Karte der
potenziellen Erosionsgefährdung der Ackerböden durch Wasser wurde
durch die BGR bereits 2014 veröffentlicht und ist eine sehr wichtige
Grundlage für eine landschaftsvergleichende Diskussion bezüglich der
Bemühungen um den Schutz den Böden gegen Erosion. Das Verständnis
dieses Buchkapitels setzt allerdings das Wissen zur ABAG voraus. Das
Subkapitel zur Bodenverdichtung enthält einige Unklarheiten:
vergleicht man die Begriffe aus dem Glossar, so werden
„Lagerungsdichte“ und „Trockenrohdichte“ synonym verwendet, was im
Sinne der Bodenkundlichen Kartieranleitung (2005), Seite 125
abweichend ist. Die Informationen zur Vorbelastung der Böden und die
Karte der Vorbelastung erfordern ebenfalls ein tieferes Vorwissen.
Der Bodenatlas endet mit einem Kapitel zu Verfahren, die das
Ertragspotenzial der Ackerböden abschätzt und somit eine Grundlage für
die Agrarwirtschaft Deutschlands gibt. Neben der bekannten Boden -
schätzung werden die Ergebnisse aus dem „Müncheberger Soil Quality
Rating“ dargestellt. Dies ist sehr löblich, weil das Verfahren einen
komplexeren Ansatz als die Bodenschätzung hat, das Verständnis dieses
Verfahrens verlangt aber vertieftes Wissen der Methode; hier wäre der
Hinweis auf die elektronisch frei verfügbare Literaturquelle hilfreich
gewesen.
Abschließend ist der „Bodenatlas“ als eine sehr zu empfehlende
Wissensquelle über unsere Böden zu bewerten. Die Zielgruppe der
Nutzer sollte allerdings bereits ein bestimmtes Vorwissen haben, um
diese komplexen Fachinformationen und Karten nutzen zu können.
Jutta Zeitz
TELMA Bd. 46, 2016