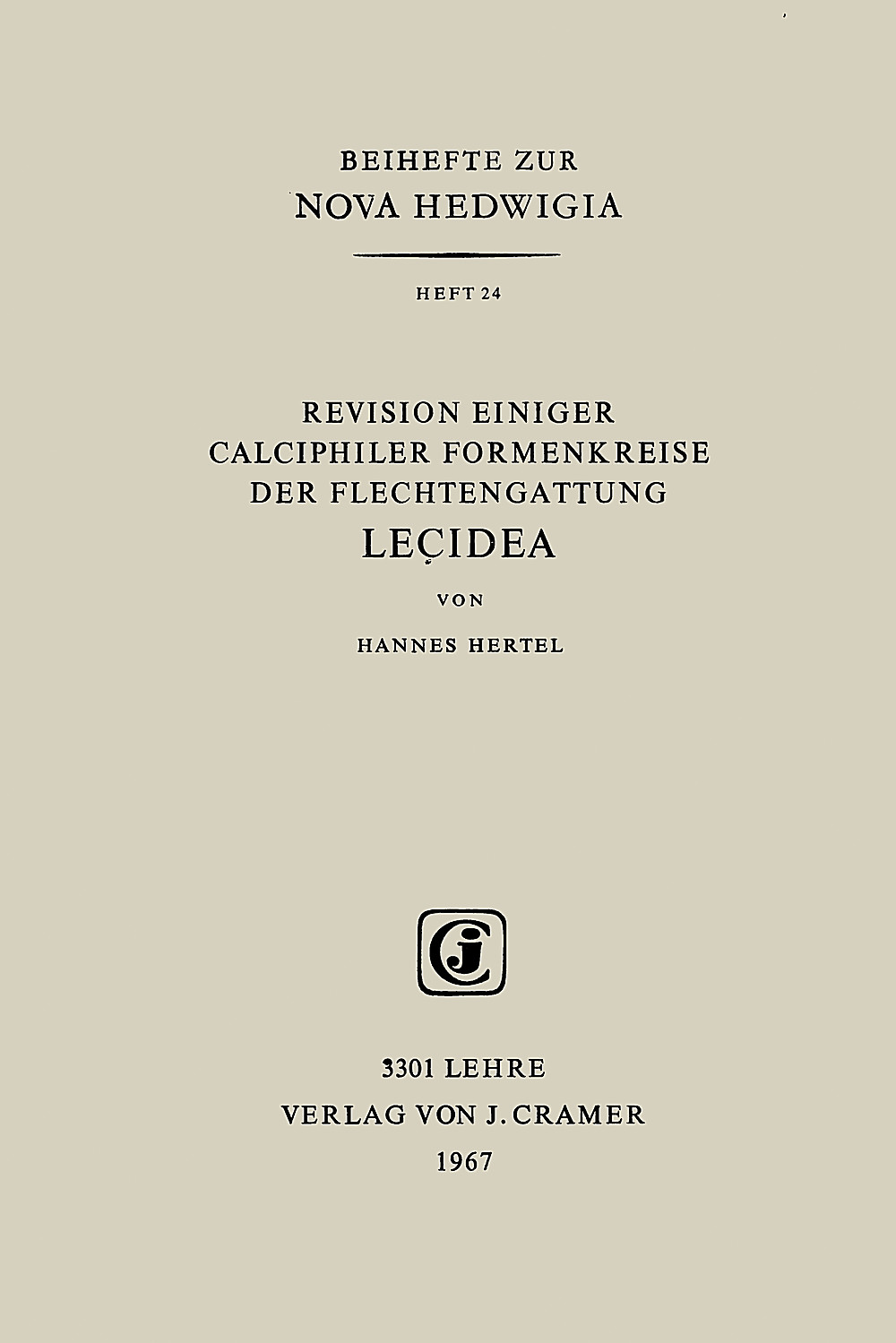Inhaltsbeschreibung Haut de page ↑
Die von Acharius 1803 auf teilweise recht heterogene Formenkreise
begründete Gattung Lecideal erhielt ihre heutige Umgrenzung (wie sie
etwa bei Grummann 1963 verwendet wird) durch Th. M. Fries 1874. Dessen
Gattungsgliederung — vier Untergattungen mit zahlreichen „stirpes“
(von Räsänen 1939 zu Sektionen kombiniert und von mehreren späteren
Autoren in ihrer Zahl vermehrt) — blieb, gestützt vor allem auf
äußerliche, chemische und, entsprechend der damaligen Optik, gröbere
anatomische Merkmale, bis heute im Prinzip unverändert und
unwidersprochen, sieht man von einem sonst wenig fundierten Vorschlag
Choisy’s (1950) ab, der besonders der Länge der Pyknosporen hohen
systematischen Wert beimißt.
Während so in der Systematik der Gattung nur geringe Fortschritte
erzielt wurden, wuchs ihr Umfang ungeheuer an. Mit 1518 heute
unterschiedenen Species (Grummann 1963 : 6) wurde Lecidea zur
artenreichsten Flechtengattung überhaupt. Kaum ein Gebiet der Erde
dürfte bekannt sein, in dem nicht Vertreter siedeln, und bezüglich der
Substratwahl scheinen ebenfalls kaum Beschränkungen zu
bestehen. Moderne kritische Übersichten, die ein größeres Gebiet
betreffen, liegen bislang nur von Skandinavien vor (Vainio 1934;
Magnusson 1952 — Schlüssel der fennoskandischen Formen: 360 Arten!).
In den Alpen waren es vor allem L. E. Schaerer, Ph. Hepp,
A. v. Krempelhuber, A. Massalongo, F. Arnold und in neuerer Zeit
J. Poelt, die dieser Gattung ihre Aufmerksamkeit widmeten und für das
Gebiet eine Fülle von Taxa nachwiesen und neu beschrieben. Deren Zahl
ist heute, vor allem auch durch die zahllosen Neubeschreibungen von
W. Nylander und J. Müller Argoviensis, so angewachsen, daß auch an
eine Gesamtdarstellung nur der alpinen Sippen dieser Gattung vorläufig
nicht zu denken ist.
Um dieser Riesengattung aber nun beizukommen, erschien es nötig,
zunächst kleinere Einheiten zu schaffen und gesondert
darzustellen. Zur Abgrenzung solcher Gruppen erwiesen sich die bisher
bekannten systematischen Merkmale aus mancherlei Gründen als
unzureichend. Auf der Suche nach geeigneteren Merkmalen fiel die Wahl
dabei auf das Substrat. (Krustenflechten zeigen nämlich durch den
unmittelbaren Kontakt mit dem Gestein eine sehr hohe
Substratspezifität. wie sie von anderen Pflanzengruppen in diesem Maße
nicht mehr erreicht wird.) So hat vorliegende Arbeit zum Ziel,
erstmals eine kritische Übersicht über jene denkbar ungenügend
bekannten, alpinen, calciphilen Lecideen der Untergattung Lecidea
sensu Th. M. Fries zu geben, die sich nach Zahlbruckner’s Catalogus
auf über 100 Taxa verteilen, und dabei Merkmale herauszuarbeiten, die
über die hier untersuchten Formenkreise hinaus einmal zur
Gattungsgliederung Verwendung finden könnten.
Behandelt wurden alle Vertreter des „Subgenus Lecidea sensu Th. Fr.
(„Eulecidea Th. Fr.“) der Alpen, soweit sie über kalkhaltigen
Gesteinen wachsen. Ausgeschlossen blieben nur ausnahmsweise auf
schwach kalkhaltige Gesteine übergreifende Silikatsippen. Angesichts
der vergleichsweise weiten Verbreitung vieler Flechten schien es
erforderlich, auch die von Th. M. Fries und B. Lynge aus der Arktis,
von W. Nylander aus den Pyrenäen, von Th. M. Fries und H. Magnusson
aus Skandinavien und die von J. Nädvornik aus der Hohen Tatra
beschriebenen calciphilen Taxa mit in die Untersuchung
einzubeziehen. In einigen Fällen wurde auch weiteres Material aus dem
übrigen Europa, der Arktis, den Rocky Mountains und asiatischen
Hochgebirgen, soweit bei der Revision vorgefunden, berücksichtigt.
Dem Charakter der Arbeit entsprechend ergab sich eine Dreigliederung
der Arbeitsweise: Merkmalsanalyse in Verbindung mit Untersuchung der
Variabilität, Typenstudium und Geländebeobachtungen.
Vielleicht im Gegensatz zu einigen silikophilen Formenkreisen der
Gattung mit unterschiedlich stark differenziertem Thallusbau kommt
Lagermerkmalen hier nur untergeordnete Bedeutung zu. Dagegen liefern
Anatomie, Chemismus und Ontogenie der Apothecien (vor allem in
Sporen-, Ascus- und Gehäusestrukturen und den überraschend
vielgestaltigen Paraphysen) wesentliche Merkmale. Geländestudien und
die Vertrautheit mit Standortsverhältnissen und Vergesellschaftungen
erwiesen sich als bedeutsam zur Klärung systematischer Fragen, gerade
weil sich diese Flechten zur Zeit noch nicht kultivieren
lassen. Reichliches Frischmaterial (24 der 30 alpinen Sippen konnten
selbst gesammelt werden), das ich auf Exkursionen in die Allgäuer,
Rhätischen, Lombardischen und Berner Alpen, ins Südtiroler Hochland
und ins Etschbuchtgebirge, in die Nordtiroler Kalk- und Salzburger
Schieferalpen sammeln konnte, erleichterte die Untersuchungen sehr
wesentlich und ermöglichte in mehreren Fällen erst die Klärung
systematischer Fragen.