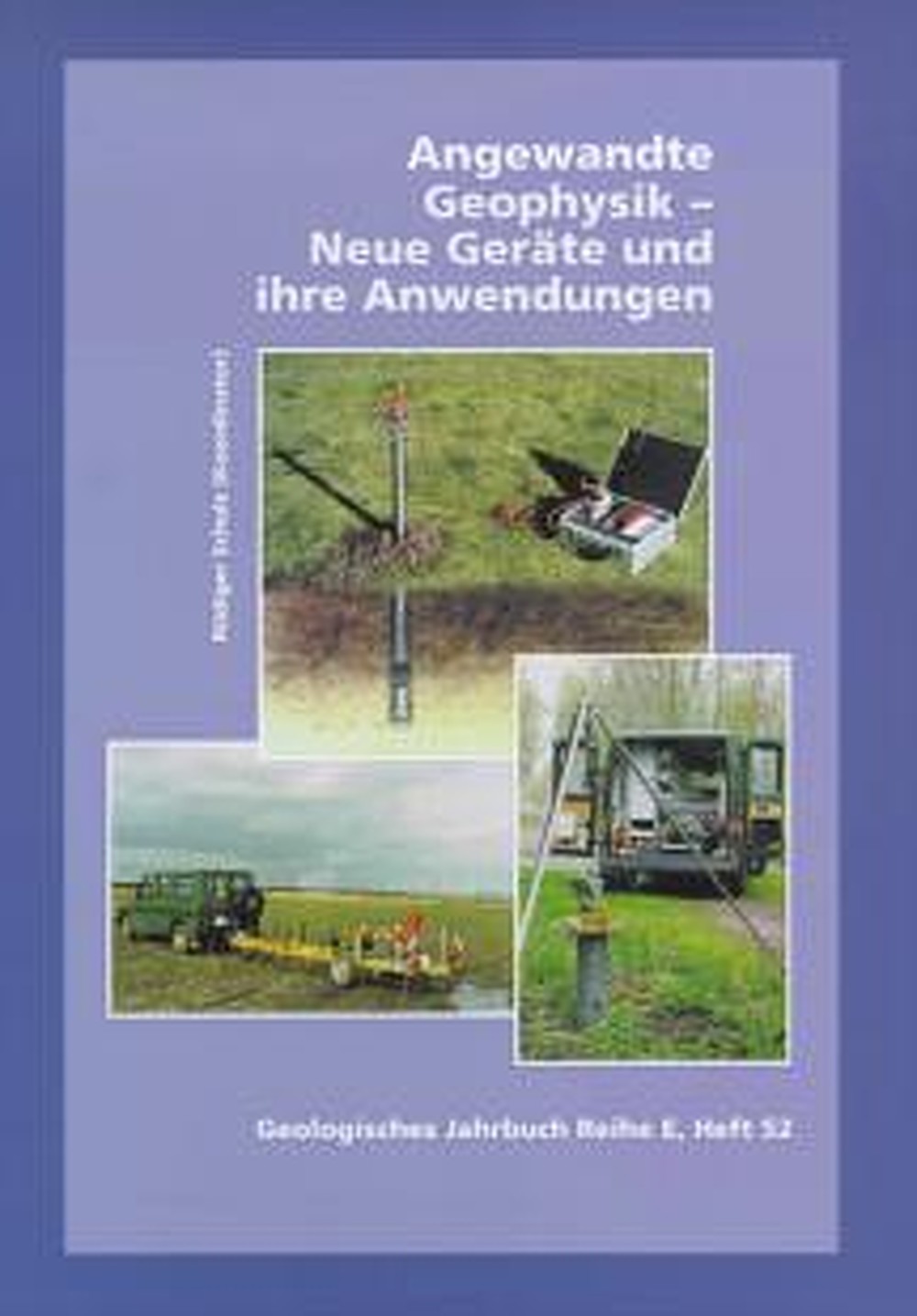Synopsis nach oben ↑
Eine der wichtigen Aufgaben der Geowissenschaftlichen
Gemeinschaftsaufgaben (GGA) besteht darin, neue geophysikalische
Geräte für die praktische Anwendung zu entwickeln bzw. bekannte
Verfahren neuen Anwendungen zuzuführen. In den letzten Jahren hat es
dabei einige interessante Entwicklungen gegeben, die für die
Spezialisten zwar sichtbar waren, aber für viele Geowissenschaftler
häufig unbekannt geblieben sind.
Das elektromagnetische Reflexionsverfahren (EMR), auch gerne als Boden-, Geo- oder Gesteinsradar bezeichnet, ist das geophysikalische Verfahren, das bei der Erkundung oberflächennaher Bereiche in den letzten Jahrzehnten die größten meßtechnischen Fortschritte gemacht hat. Wenig bekannt in Deutschland ist die Anwendung des EMR-Verfahrens in der Bodenkunde. Überraschende Ergebnisse wurden bei der Untersuchung von Bodendauerbeobachtungsflächen erzielt, die wichtige Hinweise auf die Heterogenität der zu untersuchenden Bodenproben geben. Messungen im Moor zeigen, daß das Verfahren sowohl bei der Ermittlung der Torfmächtigkeit als auch bei der Bestimmung seiner Zusammensetzung hilfreich sein kann.
Um sich schnell einen Überblick über die Leitfähigkeitsverteilung im flachen Untergrund zu verschaffen, wird gern auf altbewährte Kartierungsverfahren mittels der Gleichstromgeoelektrik zurückgegriffen. Die Entwicklung einer mobilen Elektrodengruppe erlaubt einen optimalen zeitlichen und personellen Einsatz und erweitert aufgrund der vielfältigen Elektrodenkonfigurationen wesentlich die Interpretationsmöglichkeiten bei geoelektrischen Kartierungsmessungen.
Die Seismik gilt auch für die Erkundung von flachen Strukturen als "die" Methode der angewandten Geophysik. Als Erg?nzung zu den herkömmlichen Anregungsarten wurde von den GGA zusammen mit der Industrie ein "Seismic Impulse Source System" (SISSY) entwickelt. Vorteile und Grenzen dieses Systems werden an Hand von Meßbeispielen erläutert.
Welche Möglichkeiten die Weiterentwicklung der Meßtechnik für dünne Bohrlochsonden ("slimhole") bieten und welche Ansprüche an ihre Kalibrierung hinsichtlich einer quantitativen Auswertung gestellt werden müssen, zeigt ein Artikel über die "kleine" Bohrlochgeophysik.
Die wichtige Bestimmung hydrogeologischer Parameter und das Erfassen von Grundwasserströmungen als Grundlage für langfristige Voraussagen erfordern neben einem guten Meßstellennetz auch eine hochauflösende moderne Meßtechnik. Die Aufzeichnung des Luftdruckes zusammen mit hochauflösenden Wasserspiegelmessungen ermöglicht auch Rückschlüsse auf die Gasdurchlässigkeit in der ungesättigten Bodenzone.
Kurze Umkehrungen des Erdmagnetfeldes von nur 10 000 Jahren können an Bohrkernen mit Hilfe eines Kryogenmagnetometers identifiziert werden. Diese magnetischen Bohrkernuntersuchungen können auch Beiträge zur Erforschung des Paläoklimas liefern. Dieses Heft wendet sich sowohl an den angewandten Geophysiker, der bei seinem Tagesgeschäft die gesamte Bandbreite der Geophysik bearbeiten muß, als auch allgemein an den Geowissenschaftler in den Hochschulen, in den Staatlichen Geologischen Diensten und in Ingenieurbüros. Die Artikel sollen zeigen, welche neuen geophysikalischen Geräte für mögliche gemeinsame geowissenschaftliche Untersuchungen bei den GGA zur Verfügung stehen.
Das elektromagnetische Reflexionsverfahren (EMR), auch gerne als Boden-, Geo- oder Gesteinsradar bezeichnet, ist das geophysikalische Verfahren, das bei der Erkundung oberflächennaher Bereiche in den letzten Jahrzehnten die größten meßtechnischen Fortschritte gemacht hat. Wenig bekannt in Deutschland ist die Anwendung des EMR-Verfahrens in der Bodenkunde. Überraschende Ergebnisse wurden bei der Untersuchung von Bodendauerbeobachtungsflächen erzielt, die wichtige Hinweise auf die Heterogenität der zu untersuchenden Bodenproben geben. Messungen im Moor zeigen, daß das Verfahren sowohl bei der Ermittlung der Torfmächtigkeit als auch bei der Bestimmung seiner Zusammensetzung hilfreich sein kann.
Um sich schnell einen Überblick über die Leitfähigkeitsverteilung im flachen Untergrund zu verschaffen, wird gern auf altbewährte Kartierungsverfahren mittels der Gleichstromgeoelektrik zurückgegriffen. Die Entwicklung einer mobilen Elektrodengruppe erlaubt einen optimalen zeitlichen und personellen Einsatz und erweitert aufgrund der vielfältigen Elektrodenkonfigurationen wesentlich die Interpretationsmöglichkeiten bei geoelektrischen Kartierungsmessungen.
Die Seismik gilt auch für die Erkundung von flachen Strukturen als "die" Methode der angewandten Geophysik. Als Erg?nzung zu den herkömmlichen Anregungsarten wurde von den GGA zusammen mit der Industrie ein "Seismic Impulse Source System" (SISSY) entwickelt. Vorteile und Grenzen dieses Systems werden an Hand von Meßbeispielen erläutert.
Welche Möglichkeiten die Weiterentwicklung der Meßtechnik für dünne Bohrlochsonden ("slimhole") bieten und welche Ansprüche an ihre Kalibrierung hinsichtlich einer quantitativen Auswertung gestellt werden müssen, zeigt ein Artikel über die "kleine" Bohrlochgeophysik.
Die wichtige Bestimmung hydrogeologischer Parameter und das Erfassen von Grundwasserströmungen als Grundlage für langfristige Voraussagen erfordern neben einem guten Meßstellennetz auch eine hochauflösende moderne Meßtechnik. Die Aufzeichnung des Luftdruckes zusammen mit hochauflösenden Wasserspiegelmessungen ermöglicht auch Rückschlüsse auf die Gasdurchlässigkeit in der ungesättigten Bodenzone.
Kurze Umkehrungen des Erdmagnetfeldes von nur 10 000 Jahren können an Bohrkernen mit Hilfe eines Kryogenmagnetometers identifiziert werden. Diese magnetischen Bohrkernuntersuchungen können auch Beiträge zur Erforschung des Paläoklimas liefern. Dieses Heft wendet sich sowohl an den angewandten Geophysiker, der bei seinem Tagesgeschäft die gesamte Bandbreite der Geophysik bearbeiten muß, als auch allgemein an den Geowissenschaftler in den Hochschulen, in den Staatlichen Geologischen Diensten und in Ingenieurbüros. Die Artikel sollen zeigen, welche neuen geophysikalischen Geräte für mögliche gemeinsame geowissenschaftliche Untersuchungen bei den GGA zur Verfügung stehen.