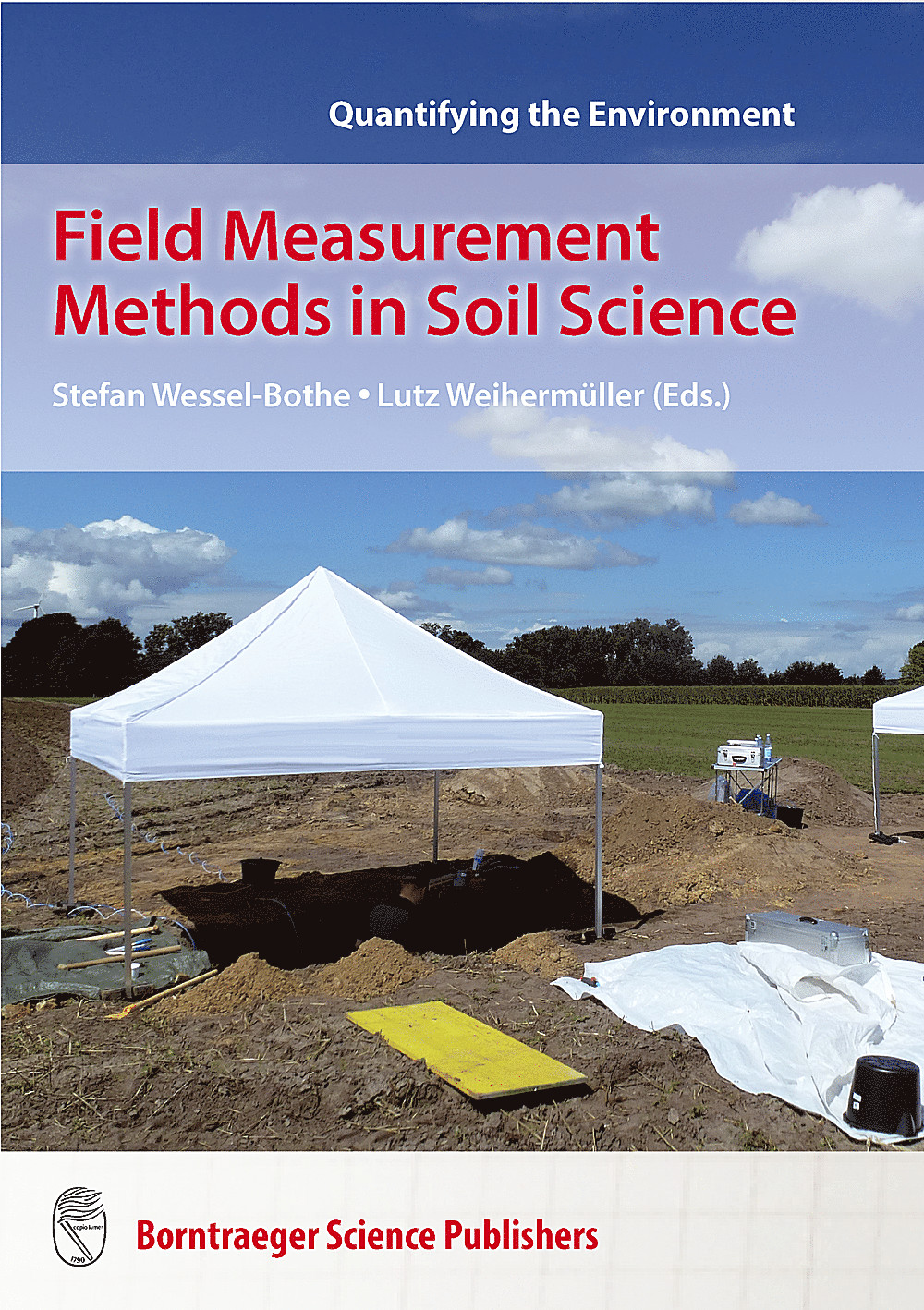Bodenkundliche Analysen und Messungen finden zu einem überwiegenden Teil unter gut standardisierbaren Bedingungen im Labor statt. Manche Bodeneigenschaften können jedoch ausschließlich im Feld bestimmt werden, weil bei einer Probenentnahme der Boden soweit verändert würde, dass die zu messende Eigenschaft nicht mehr bestimmbar ist. Dazu gehören vor allem, aber nicht ausschließlich, physikalische Bodeneigenschaften, da diese sehr häufig unmittelbar mit der aktuellen Porenstruktur Zusammenhängen. Der Erfolg von Feldmessverfahren im Hinblick auf die Qualität und Reproduzierbarkeit der Daten hängt sehr häufig unmittelbar mit praktischen Erfahrungen bei der Anwendung dieser Verfahren zusammen. Durch die große Praxisnähe schließt das Buch eine wichtige Lücke zwischen der Theorie von Feldmessverfahren, die in vielfältiger Literatur beschrieben werden, und praktischen Handlungsempfehlungen für z.B. den Einbau der Geräte und den Betrieb dieser Verfahren, die zwar bei vielen praktischen Anwendern bekannt, aber meist nicht in wissenschaftlichen Veröffentlichungen dokumentiert sind.
Die Herausgeber stellen in dem Buch in 9 Kapiteln wesentliche bodenkundliche Feldmessverfahren vor. Dazu gehören die physikochemischen Messungen von Redoxpotential und pH in-situ, bodenhydrologische Messungen wie Wassergehalte und Matrixpotentiale, Bodenwasserentnahmen und Infiltrationsmessungen, und bodenmechanische Verfahren wie Erosionsmessungen und Eindringwiderstands-messungen.
Alle Kapitel sind ähnlich aufgebaut. Sie beginnen jeweils mit einer relativ kurzgefassten theoretischen Einführung in das Messverfahren und der technischen Beschreibung der Geräte. Im Praxisteil wird jeweils ausführlich beschrieben, welches Material benötigt wird und wie konkret Einbau und Messung erfolgen. Bei vielen der beschriebenen Verfahren gibt es Installationshinweise, z.B. ob Einbau in eine Profilwand oder aber Bohrlöcher von oben besser sind, und häufig Hinweise darauf, ob Geräte ggf. im Eigenbau hergestellt werden können. Anschließend wird bei allen Verfahren auf die notwendige Anzahl von Messwiederholungen, mögliche Fehlerquellen, Wartung der Geräte und Interpretation der Messwerte eingegangen. Zum Abschluss jeder Beschreibung gibt es Hinweise auf weitere mögliche Messverfahren und Literaturverweise. Für alle Verfahren werden u.a. Quellen nach DIN angegeben, häufig zusätzlich noch Hinweise auf ASTM (American Society for Testing and Materials) als internationaler Standard.
In dem Kapitel „Allgemeine Einführung" wird kurz auf wesentliche Aspekte eingegangen, die für praktisch alle Feldmessungen von Bedeutung sind, wie z.B. räumliche Variabilität, Anzahl Wiederholungen, räumliche Auflösung und Installationsweisen von Sensoren. Im Kapitel „Redoxpotential" wird der Einsatz von Pt-Elektroden in Verbindung mit einer Referenzelektrode vorgestellt und auch auf eine Verbesserung der Messgenauigkeit im trockenen Boden mithilfe einer Salzbrücke eingegangen. Im Kapitel „pH" werden kurz typische Labor-pH-Messverfahren vorgestellt, insbesondere auch Umrechnungsmöglichkeiten zwischen verschiedenen Messverfahren (pHH2O:pHCaCl2; pH1:2:pH1:5; pHKCl:pHCaCl2 u.a.). Anschließend wird auf in-situ-Messungen mit stationären pH-Elektroden und auf automatisierte Messungen mit fahrbaren Geräten im Rahmen von Precision Farming eingegangen. Den Abschluss bilden Hinweise auf räumliche Beprobungsstrategien. Im Kapitel „Wassergehaltsmessungen" werden die theoretischen Messprinzipien elektromagnetischer Sensoren zur Messung des volumetrischen Wassergehalts und deren wesentliche Einsatzmöglichkeiten kurz vorgestellt, d.h. TDR- und FDR- und kapazitive Sensoren, und TDT-(time domain transmission)-Sen-soren. Weitere mögliche Verfahren, z.B. geophysikalische Messmethoden (Bodenradar, elektromagnetische Induktion) oder Sensoren basierend auf der Messung kosmischer Strahlung (Cosmic Ray Neutron Probe) werden zumindest kurz mit Literaturhinweisen erwähnt. Im Kapitel „Matrixpotentialmessungen" werden verschiedene Tensiometerbauformen, Gipsblockelektroden und verwandte Messprinzipien, Equitensiometer (Kombination aus porösem, meist keramischem Material und FDR-Sensoren) und Messverfahren, die auf der Wärmekapazität in Abhängigkeit vom Wassergehalt beruhen, vorgestellt. Hilfreich sind auch Hinweise zur Auswahl der verschiedenen Sensoren in Anhängigkeit von den Untersuchungszielen. Im Kapitel „Entnahme von Bodenlösung" werden Saugkerzen und die Eignung verschiedener Saugkerzenmaterialien in Abhängigkeit von der Substanz, die analysiert werden soll, beschrieben. Weitere vorgestellte Verfahren sind Saugplatten und deren in-situ Einbau, einfache passive Sammler (Pan lysimeters), Kapillardocht-Bodenwasser-sammler und Lysimeter. Ausführlich wird auch auf besondere Anforderungen bei der Beprobung bestimmter Substanzen, z. B. Nährstoffe, Spurenmetalle, organische Stoffe, Kolloide und Mikroorganismen eingegangen. Im Kapitel „Infiltration und Wasserleitfähigkeitsmessungen" wird in Verfahren im ungesättigten Bereich (Bodenoberfläche, Unterboden) und im Grundwasser unterschieden. Ausführlich wird auf Ring- und Doppelringinfiltrometer (Bodenoberfläche), Hauben- und Tensionsinfiltrometer (Bodenoberfläche), Guelph-Permeameter (Messung der Wasserleitfähigkeit im Unterboden) und das Bohrlochverfahren im gesättigten Bereich eingegangen. Im Kapitel „Bodenerosion" werden Regensimulatoren und Sedimentfallen zur Messung erosiver Abträge und Verfahren zur Ermittlung rillenhafter Erosion vorgestellt, d. h. Grundlagen der LaserProfilaufnahme und die Markierung erosiver Fließwege mit Farbmarkern. Den Abschluss des Buches bildet das Kapitel über „Eindringwiderstandsmessungen": Hier wird auf die leichte Rammsonde (DPL10) und Penetrographen bzw. Penetrologger und deren Datenauswertung eingegangen. Kein Buch über Messverfahren kann vollständig sein. Ergänzt werden könnten z. B. Hinweise auf Sensoren für z. B. Nährstoffe und organische Substanz, oder auf Messverfahren aus der Bodenbiologie, wie z. B. die Bodenatmung. Dies mindert aber in keiner Weise die hervorragende praxisnahe Beschreibung der in dem Buch enthaltenen wichtigsten bodenkundlichen Feldmessverfahren.
Das Buch ist sehr nützlich für alle diejenigen, die diese bodenkundlichen Feldmessverfahren neu einsetzen wollen. Sie sind eine wichtige Entscheidungshilfe dafür, welche Verfahren für die jeweilige Untersuchungsfragestellung geeignet sind und können dabei unterstützen, Fehler, die bei der Anwendung der Verfahren entstehen, zu vermeiden. Durch die Verbindung von kurzgefassten theoretischen Informationen mit sehr praktischen Handlungsempfehlungen kann es sicherlich auch sehr effektiv in der bodenkundlichen Lehre eingesetzt werden.
Prof. Dr. Rüdiger Anlauf, HS Osnabrück
4-20 Bodenschutz, Seite 179