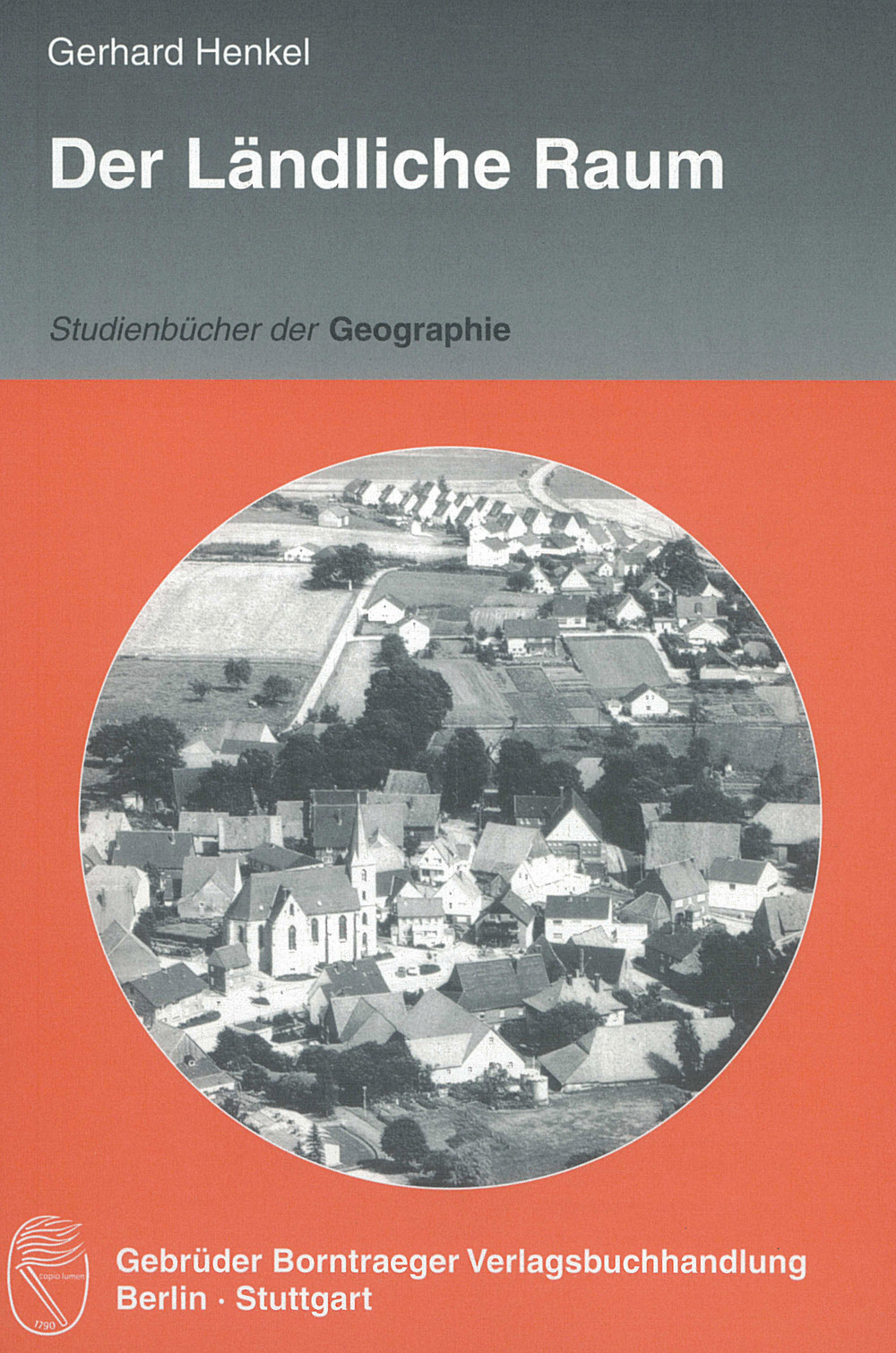Das Dorf lebt
Gerade junge Familien wohnen gern im Grünen, im öffentlichen
Bewusstsein aber spielt der ländliche Raum kaum eine Rolle
Trotz Landflucht wohnt jeder zweite Deutsche auf dem Land - naturnah,
im Eigenheim, eingebettet in soziale Netze und meistens glücklicher
als die Großstädter.
Wenn nicht gerade die Kohlebagger kommen, wie in Otzenrath, das
komplett umgesiedelt wurde. Das Dorf ist auch Schwerpunktthema der
Grünen Woche in Berlin.
Das Dorf hat es nicht leicht. Es ist die beliebteste aller
Siedlungsformen, erfährt jedoch durch Medien, hohe Politik und
Wissenschaften eine eher geringe Wahrnehmung und Wertschätzung. Die
Beschreibungen und Bewertungen des Dorfs sind oft widersprüchlich: Mal
wird sein Ende beschworen, dann wieder wird es als Garten Eden oder
Aktivposten des Staats gepriesen.
Wie kommt es zu diesen Marginalisierungen und widersprüchlichen
Bewertungen des Dorfs? Die Antwort ist zunächst einfach: Das Dorf ist
nicht leicht zu fassen. Zum einen haben die fließenden, aber
durchschlagenden Wandlungsprozesse von der Agrar- zur Industrie- und
Städtegesellschaft besonders in den vergangenen sechzig Jahren auch
den ländlichen Raum nachhaltig verändert. Das Dorf hat - von Region zu
Region und von Ort zu Ort sehr unterschiedlich - seine Gestalt, seine
überkommenen Funktionen, seine traditionellen Lebensinhalte gewandelt.
Ein paar Zahlen: Von den hundert bis 150 Bauernhöfen, die um 1950 noch
in mittelgroßen Dörfern bestanden, sind bis heute höchstens zehn bis
15 übrig geblieben. Ähnliche Verluste gelten für das Dorfhandwerk und
die Forstwirtschaft. Dazu kommen gravierende Infrastrukturverluste:
Post, Molkerei und Polizeiposten, Schule, Bürgermeisteramt und
Rathaus, Gasthöfe und Läden, Genossenschaft.
Eine weitere Zugangshürde besteht darin, dass es das Dorf oder den
ländlichen Raum nicht gibt. Dörfer und ländliche Regionen sind äußerst
vielfarbig und tiefgründig zugleich. Ihre ausgeprägten regionalen und
lokalen Individualitäten, ihre vielschichtigen Potenziale und Probleme
entziehen sich einer einfachen Darstellung und Generalisierung. Welche
Region könnte den ländlichen Raum in Deutschland repräsentieren: die
Einzelhof- und Streusiedlungsgebiete im Nordwesten oder die
städteähnlichen Dorflandschaften des Südwestens, die Gutsdörfer
Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommerns, die Klosterdörfer
Bayerns und Westfalens oder die Arbeiterbauerndörfer des Saarlands und
Sachsens, die Dörfer und Weiler des Mittelgebirges oder der Küste, die
Bördendörfer oder die Winzerdörfer Süddeutschlands?
Die größte Aufmerksamkeit gilt meist den peripheren Dorfregionen
abseits der Ballungsgebiete und Großstädte, die - vor allem im
deutschen Nordosten - von Abwanderung und Stagnation betroffen sind.
Den Gegenpol bilden die ballungsraum- und großstadtnahen Dörfer, die
permanentem Siedlungsdruck ausgesetzt sind. Dazwischen liegt die große
Gruppe der Dörfer im Einflussbereich von Klein- und Mittelstädten.
Dorfregionen mit sehr hohen und sehr niedrigen Arbeitslosenquoten
stehen einander gegenüber, ohne dass man auf den ersten Blick deren
Ursachen erkennt. Generell gibt es große Unterschiede zwischen kleinen
Dörfern mit etwa hundert Einwohnern und großen bis zu 10 000
Einwohnern, nicht nur bei den Arbeitsplätzen und der
Infrastrukturausstattung, sondern beispielsweise auch im Vereinsleben.
Wer vermag ein "typisches" Dorf zu benennen oder zu definieren? Selbst
kleinräumige Vergleiche zwischen benachbarten Dörfern lassen oft
Kontraste bezüglich des Siedlungsbilds, des Wirtschafts- und
Sozialgefüges sowie der Entwicklungsdynamik erkennen.
Rein numerisch hat der ländliche Raum noch ein großes Gewicht: Gut die
Hälfte der Bevölkerung und 90 Prozent der Fläche des Staats gehören
zum ländlichen Raum. Auch ökonomisch ist der ländliche Raum nicht von
vornherein das Armenhaus der Nation. Natürlich gibt es viele ländliche
Gebiete, die von hoher Arbeitslosigkeit und Abwanderung betroffen
sind. Auf der anderen Seite stehen jedoch reiche oder aufstrebende
Agrarlandschaften mit baulich und infrastrukturell attraktiven und
intakten Dörfern. So finden sich beispielsweise in Westfalen oder
Baden-Württemberg prosperierende Dorflandschaften mit sehr geringer
Arbeitslosigkeit und zahlreichen mittelständischen Firmen, die
erfolgreich für den Weltmarkt produzieren.
Dennoch spielt der ländliche Raum im öffentlichen Bewusstsein eine
geringere Rolle, als ihm eigentlich zusteht. Wie ist dies zu erklären?
Der Hauptstrom der Meinungsbildung in unserer Gesellschaft geht von
den Zentren der Medien, Politik, Wissenschaften und (Hoch-)Kultur aus,
die nun einmal in den großen Städten sitzen. Die Perspektive auf das
Dorf ist somit in der Regel eine Fernsicht, die politische,
wissenschaftliche und mediale Behandlung oft eine Fern- und
Fremdsteuerung. Wissenschaftler und Redakteure suchen lieber die Nähe
zu den (Fördertöpfen der) Ministerien und Kulturverwaltungen als zu
den ländlichen Bürgermeistern oder Dorfvereinen. Manchmal sind es auch
konkurrierende Interessenverbände, die den ländlichen Raum gezielt
klein- oder schlechtreden. So sprechen die Präsidenten des Bayerischen
Städtetags davon, dass der ländliche Raum nur noch ein "gedankliches
Kunstprodukt" und alles doch längst Stadt(region) sei.
Wo liegen - generalisiert - die Besonderheiten, die Stärken und
Schwächen des ländlichen Raums? Obwohl etwa zwei Drittel aller
deutschen Dörfer seit 1945 an Einwohnern gewachsen sind, gingen
zahlreiche Arbeitsplätze und Infrastruktureinrichtungen verloren.
Allerdings stehen diesen Verlusten auch Gewinne gegenüber: Wasser-,
Abwasser-, Energieversorgung, Sport-, Freizeit- und
Kultureinrichtungen wie Dorfgemeinschaftshaus, Heimatstube und
Brauchtumspflege. Als neuer Trend ist zu beobachten, dass - fast
unsichtbar - moderne private Dienstleistungen wie Versicherungen,
Steuer- und Unternehmensberatung, Soft- und Hardwareentwicklung ins
Dorf Eingang gefunden haben. Ein zentrales Problem ist derzeit der
Leerstand vieler älterer Gebäude samt Gärten in den Dorfkernen. Da
gerade diese Anwesen, deren Verschwinden droht, oft das Dorfbild
prägen, geht es an die Substanz. Hier sind neben den Fachbehörden vor
allem auch die ländlichen Kommunen gefordert, sinnvolle Um- und
Weiternutzungen zu unterstützen, damit die alten Dorfkerne für die
nächste Generation nicht verloren gehen.
Ein wesentlicher Vorzug des Dorfs liegt neben der sehr hohen
Eigenheimquote in den "weichen" Faktoren seiner Lebensqualität
beziehungsweise Lebensstile, die es trotz aller Angleichungsprozesse
zwischen Stadt und Land immer noch gibt. Ländliche Lebensstile sind
natur-, traditions- und handlungsorientiert. Durch seine Naturnähe
bietet das Dorf in Feld, Wald und Garten eine unmittelbare Chance der
Erholung, Entspannung, Freizeitnutzung und körperlichen Betätigung.
Vor allem der dörfliche Garten gilt inzwischen als ein Kernbestand
ländlicher Lebensqualität.
Dörfliche Lebensstile sind durch eine überdurchschnittlich hohe Dichte
sozialer Netze und Kontakte geprägt. Verwandtschafts- und
Nachbarschaftshilfe, Engagement in Vereinen und Kirchen sowie
Brauchtumspflege spielen im Zusammenleben wichtige Rollen und tragen
sowohl zum Wohlstand als auch zur Identität in den Dörfern bei. So
gibt es Dörfer, in denen Vereine ehemals kommunale Freibäder
ehrenamtlich führen. Gerade junge Familien mit kleinen Kindern
schätzen das Leben auf dem Lande mit Haus und Garten. Die
Zufriedenheit der Landbewohner mit ihrem Umfeld ist nach wiederholten
Umfragen stets doppelt so hoch wie das der Großstadtbewohner.
Die Faszination des Dorfs als Lebensraum ist also ungebrochen. Das
"flache" Land hat auch deshalb Zukunft, weil Dörfer und Kleinstädte
vergleichsweise sehr viel mehr Kinder produzieren, aufziehen und
beschulen als Großstädte. Nach einem kürzlichen Zeitungsbericht
kommen auffällig viele Chefs der größten deutschen Unternehmen aus
ländlichen Regionen. Als wesentliche Erklärung für dieses Phänomen
werden die auf dem Dorf oder in der Kleinstadt erworbenen sozialen und
emotionalen Kompetenzen sowie ein auf dem Lande noch vorhandenes
"Arbeitsethos" angeführt, die sich so in der unpersönlicheren und
virtuelleren Großstadt nicht erlernen lassen. Die hoch entwickelte
Fähigkeit der Menschen im ländlichen Raum zum eigenständigen und
ehrenamtlichen Handeln ist eine bedeutende Zukunftsressource für
unseren Staat. Die Partizipationstraditionen im ländlichen Raum
bedürfen allerdings der Respektierung und Förderung.
Gerhard Henkel
Frankfurter Rundschau 17.01.2007