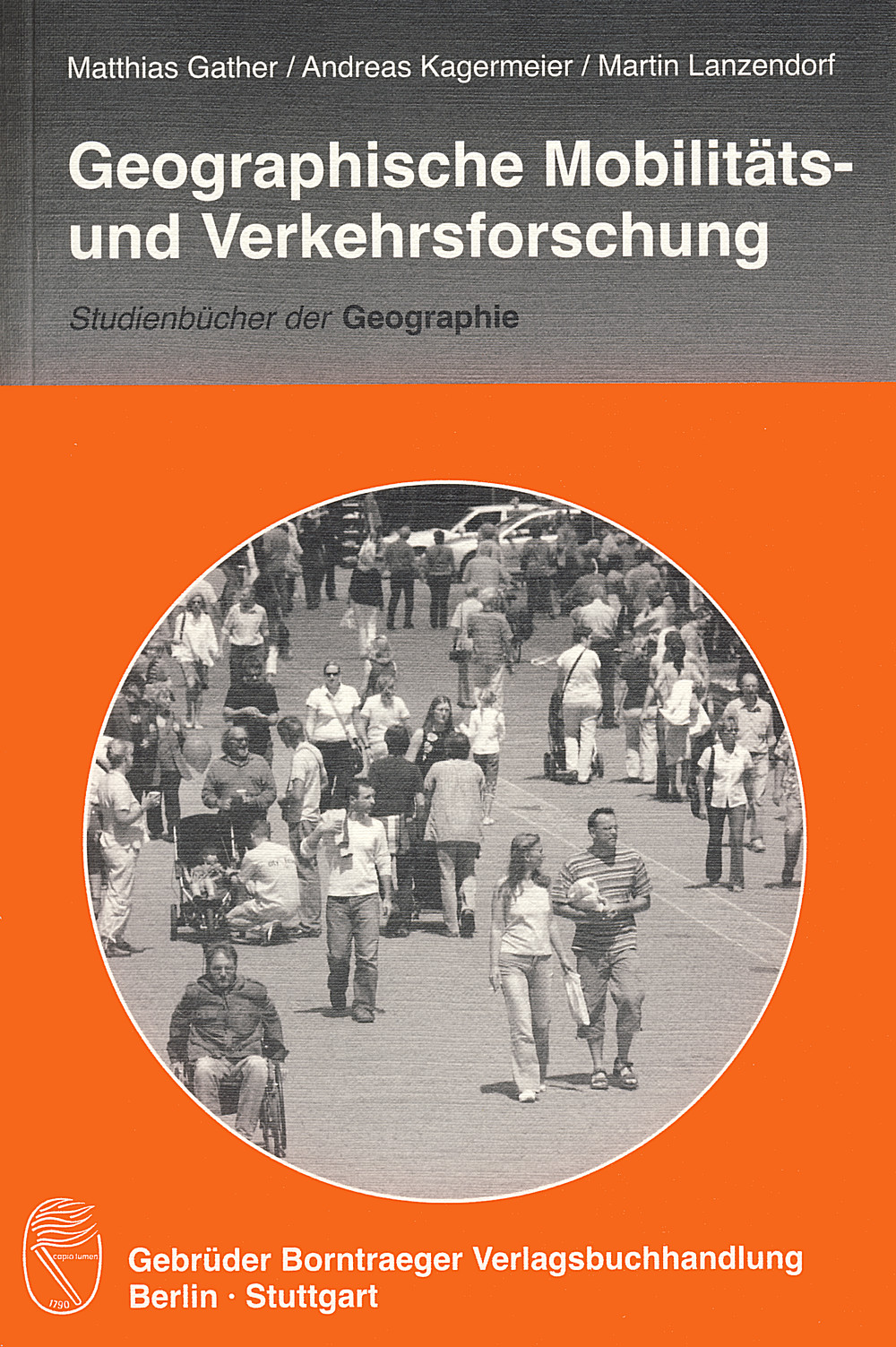Der Beitrag der Geographie zur interdisziplinären Mobilitäts- und
Verkehrsforschung hat in den letzten Jahren an Ansehen gewonnen. Das
beruht nicht zuletzt auf der dem Fach eigenen integrativen
Betrachtungsweise und der empirischen Ausrichtung wirtschafts- und
sozialgeographischer Forschung. Dabei stehen die maßgeblichen
Bestimmungsgründe der Verkehrsmobilität, Wechselwirkungen zwischen
Verkehr und Raumstruktur sowie die Auswirkungen von Planung und
Politik im Vordergrund. Konzepte „nachhaltiger Mobilität“ sollen zur
Minderung der Umweltbeeinträchtigungen durch den Verkehr
beitragen. Durch systematische Verknüpfung der genannten Aspekte
wollen die drei Autoren des hier besprochenen Buches „Geographische
Mobilitäts- und Verkehrsforschung“ einen vertieften Einblick in ein
interdisziplinäres Forschungs- und Handlungsfeld geben. Zum neuen
Grundriss der „Verkehrsgeographie“ von Nuhn und Hesse
(vgl. Besprechung in Heft 2/2007 dieser Zeitschrift), dem eine
sektorale, von den Verkehrsträgern ausgehende Betrachtungsweise
zugrunde liegt, stellt der integrative Ansatz des vorliegenden
Lehrbuchs eine interessante Alternative dar.
Nach Klärung wichtiger Grundbegriffe und Sachverhalte (Kap. 1) beginnt
die Darstellung daher mit den gesellschaftlichen und
gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen von Mobilität und Verkehr
(Kap. 2) sowie den Handlungsfeldern und Instrumenten der
Verkehrspolitik (Kap. 3). Während die sozialen Aspekte des Verkehrs
(Kap. 4) zunächst nur beispielhaft erörtert werden, sind die
volkswirtschaftlichen Aspekte des Verkehrs (Kap. 5) Gegenstand einer
systematischen, breit angelegten Darstellung. Sie reicht von den
Auswirkungen des Verkehrswegebaus auf die Regionalentwicklung über
Fragen der Verkehrsmarktordnung und des Wettbewerbs (mit empirischen
Beispielen) bis zum Problem externer Verkehrskosten und der Forderung
nach „Kostenwahrheit“ im Verkehr.
Dies hätte ein Bezugspunkt sein können für die nachfolgend behandelten
Umweltwirkungen des Verkehrs einschließlich der Verfahren und Konzepte
zur Bewertung und Minderung solcher Wirkungen (Kap. 6). Stattdessen
lässt die ausgewogene, durch widersprüchliche Befunde und Sichtweisen
nicht gestörte Darstellung die Konfliktträchtigkeit dieses Forschungs-
und Handlungsfeldes nur erahnen. Kapitel 7 ist den Wechselwirkungen
von Raum- und Verkehrsentwicklung gewidmet. Doch geht es hier primär
um den Einfluss räumlicher Gegebenheiten auf die Verkehrsentstehung
(zum Einfluss neuer Verkehrswege auf die Raumentwicklung siehe
Kap. 5). Da Verkehrsvorgänge Teil des menschlichen Handelns sind, ist
die Suche nach den Ursachen von Mobilität und Verkehr nur im Kontext
der sozialen bzw. wirtschaftlichen Bestimmungsgründe sinnvoll. Der
Begriff „induzierter Verkehr“ wird zweifellos überfordert, wenn er auf
alle durch Neu- oder Ausbau der Verkehrsinfrastruktur ausgelösten oder
veränderten Verkehrsströme angewandt wird. Verkehrsverlagerungen
(räumlich oder modal) ließen sich ebenso wenig davon trennen wie
Neuverkehr aufgrund von Siedlungstätigkeit oder
Wirtschaftsansiedlung. In der Fachliteratur wird der Begriff seit
Langem kontrovers diskutiert.
Die individuellen bzw. einzelwirtschaftlichen Bestimmungsgründe des
Verkehrs sind Gegenstand der folgenden Kapitel. Durch den Einschub der
Umwelt- und Raumwirkungen des Verkehrs leidet der Zusammenhang mit den
gesellschaftlichen und gesamtwirtschaftlichen Einflüssen und
Auswirkungen. In Kapitel 8 werden die theoretischen und methodischen
Grundlagen zur Erklärung und empirischen Erfassung des
Personenverkehrs dargestellt. Dabei werden zahlreiche neuere Theorien
und Hypothesen aus Geographie und Nachbarwissenschaften inhaltlich
anspruchsvoll, doch gut lesbar präsentiert. Die Anleitung zu eigenen
Erhebungen ist für ein Studienbuch natürlich sehr nützlich.
Demgegenüber fällt Kapitel 9 zu den Bestimmungsgründen und
Entwicklungstendenzen im Güterverkehr deutlich ab. Relevante
Erklärungsansätze zum Strukturwandel und zur Dynamik des
Transportsektors vermisst man ebenso wie eine Anleitung zur Bestimmung
relevanter Maßzahlen zur Quantifizierung der Veränderungstendenzen im
Güterverkehr. Logistische Dienstleistungen spielen für die heutige
Transportwirtschaft eine zentrale Rolle. Dennoch wäre es verfehlt, den
Strukturwandel primär auf den Logistikeffekt zurückzuführen. Mit
Ausnahme des Seecontainerverkehrs und der intermodalen Transporte
wirkt die Darstellung der verschiedenen Verkehrsträger wie eine
Pflichtübung der Autoren – zu wenig inspiriert durch neuere empirische
Befunde.
Auf „klassisch geographische“ Weise wird das Lehrbuch beschlossen
durch Ausführungen über die Verkehrsentwicklung in urbanen (Kap. 10)
und ländlichen Räumen (Kap. 11) sowie außerhalb der
hochindustrialisierten Staaten (Kap. 12). Sie enthalten eine anregende
Fülle empirischer Beispiele und Planungsfälle und gleichen gewisse
Defizite des zuvor besprochenen allgemeinen Teils aus. „Auf dem Weg
zur nachhaltigen Mobilität“ (Kap. 13) konstatieren die Autoren
abschließend zwar noch keine Trendwende, aber „Hoffnung auf eine
allmähliche Umkehr“ (S. 276). Alles in allem stellt das Lehrbuch einen
wichtigen Beitrag der Geographie zur interdisziplinären Mobilitäts-
und Verkehrsforschung dar, das vor allem Studierenden – auch außerhalb
der Geographie – empfohlen werden kann (auch dann, wenn das erwähnte
Buch von Nuhn und Hesse schon im Regal steht).
Jürgen Deiters (Osnabrück)
Raumforschung und Raumordnung Heft 3, 67. Jg., S. 277