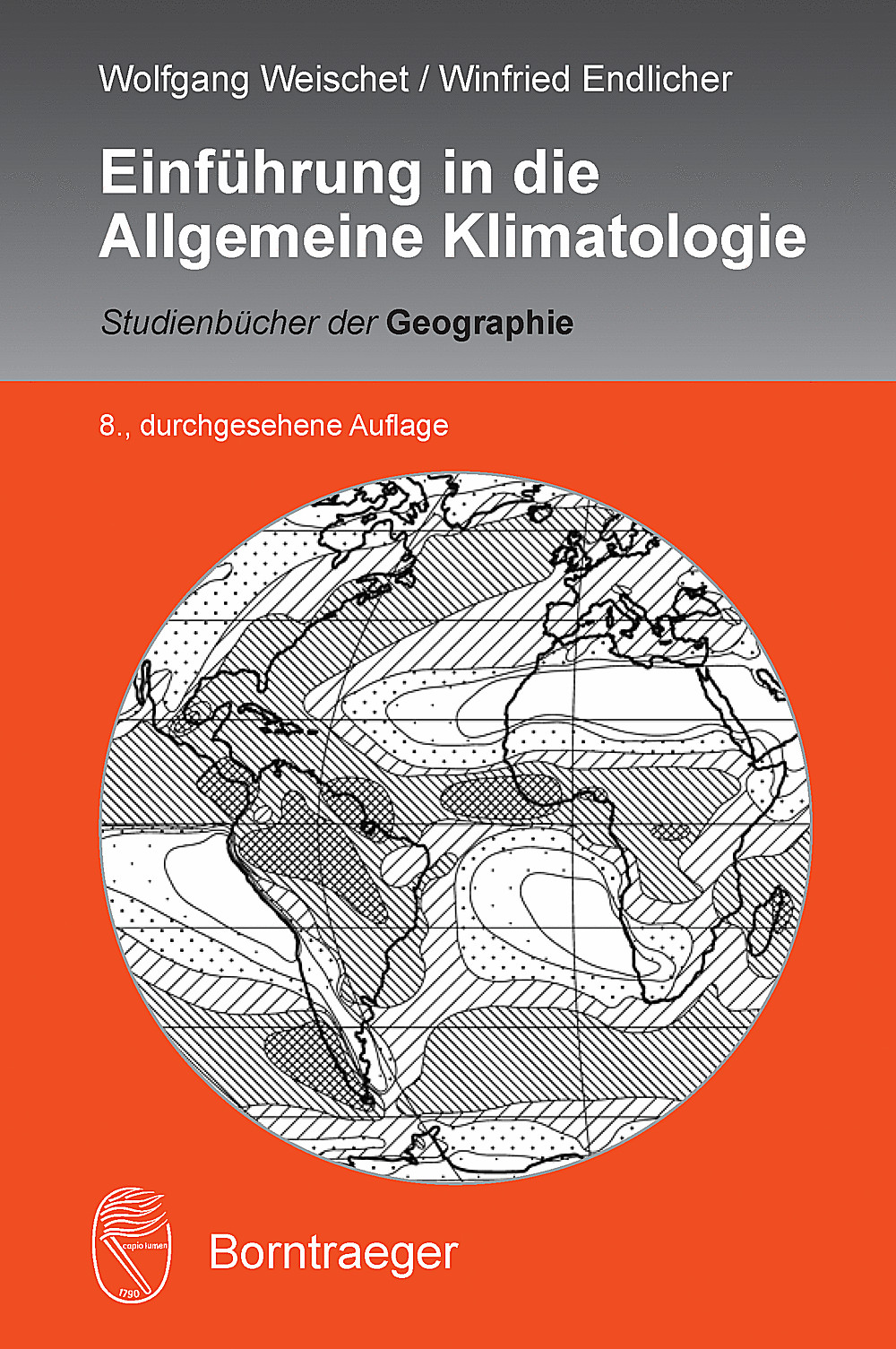Neben dem “großen” Weischet (Blüthgen/Weischet 1980) zählt der hier zu
besprechende “kleine” Weischet seit über dreißig Jahren zum
Lehrbuchbestand in der Klimatologie und hat Generationen von
Studenten, so auch den Rezensenten, fachlich geprägt. Die aktuelle
Auflage wurde von Wilfried Endlicher bearbeitet und um drei Kapitel
ergänzt. Wolfgang Weischet, der 1998 starb, hatte die sechste Auflage
(1994) noch verfasst. Von dieser erschien 2002 ein unveränderter
Nachdruck. Im Vergleich zur Vorgängerauflage hat der Umfang der
7. Auflage um 66 Seiten auf nunmehr 342 Seiten zugenommen. Das Buch
gliedert sich in 18 Kapitel, wobei diese zum Teil sehr
unterschiedliche Umfänge aufweisen. Hinzukommen ein
Literaturverzeichnis, ein ausführliches Register sowie eine
Zusammenstellung wichtiger Internetadressen zu Klimafragen und ein
kurzer Anhang, der die verwendeten Maßeinheiten nebst ihren
Erläuterungen enthält. Das Buch stellt dem Titel nach eine
“Einführung” dar und wird auch unter diesem Aspekt rezensiert.
Kapitel 1 (“Das Klima mit seinen Raum- und Zeitdimensionen”) enthält
eine Zusammenstellung verschiedener Klimadefinitionen über einen
Zeitraum von mehr als 150 Jahren, wodurch auch die unterschiedlichen
Schwerpunktsetzungen durch die jeweiligen Verfasser verdeutlicht
werden. Ferner werden die Komponenten des Klimasystems erläutert und
mit übersichtlichen Tabellen dargestellt (jedoch sollte in Tab. 1.2,
S. 19, der Höchstwert der vertikalen Skala nicht mit 104 km angegeben
werden, sondern mit 101 km oder höchstens 102 km).
In Kapitel 2 (“Erddimensionen und Beleuchtungszonen”) werden neben den
Erdgrößen himmelsmechanische Tatsachen behandelt, wobei anschauliche
Abbildungen (Fig. 2.5 und 2.6) über die entsprechenden Sonnenstände
und Tageslängen den Text ergänzen.
Kapitel 3 (“Die Sonne als Energiequelle und die Ableitung des solaren
Klimas”) erläutert die solare linebreak Energiequelle und die Fakten
des solaren Klimas.
Kapitel 4 (“Die Atmosphäre, ihre Zusammensetzung und Gliederung”)
widmet sich den atmosphärischen Inhaltsstoffen und der Unterteilung
der einzelnen Atmosphärenschichten mit Hilfe des vertikalen
Temperaturverlaufs. Dass der Text des Buches wie der Klappentext
verheißt, nicht vollständig überarbeitet wurde, verraten gelegentlich
eingestreute etwas ältere Beispiele, so das
Saharastaubtransportereignis aus dem Jahre 1901, für das es auch aus
jüngerer Zeit Belege gibt. Kapitel 5 (“Die solaren Strahlungsströme
unter dem Einfluss der Atmosphäre”) behandelt die Probleme der
Strahlungsextinktion und die Wirkung des “Ozonlochs” auf die im
Wesentlichen antarktischen Klimabedingungen. Für den Abschnitt über
die Wirkungsweise des stratosphärischen Ozons hätten die wesentlichen
Reaktionsgleichungen im Text sicher das Verständnis und den Überblick
erhöht. Der zweite Teil dieses Kapitels geht auf die geographische
Verteilung der Globalstrahlungsströme sowie auf den Strahlungsumsatz
an der Erdoberfläche für verschiedene Oberflächenbedeckungen ein.
In Tab. 5.3 (“Mittlere Werte thermischer Größen”) haben sich zwei
Fehler bei der Einheitenangabe für Dichte und spezifische Wärme
eingeschlichen: Die Zehnerpotenzen müssen jeweils mit einem positiven,
statt mit einem negativen Vorzeichen versehen werden.
In Kapitel 6 (“Die terrestrischen Strahlungsströme und der
Treibhauseffekt der Atmosphäre”) werden die Probleme des natürlichen
und anthropogenen Treibhauseffektes behandelt. Die Angaben zu den
klimawirksamen Spurengasen basieren im Wesentlichen auf Angaben des
IPCC-Berichtes aus dem Jahre 2001.
Kapitel 7 (“Die Strahlungsbilanz, lokal, regional und global”) legt
die Grundlagen für die energetischen Umsätze an der Erdoberfläche. Die
allgemeine Strahlungsbilanz wird anfangs mit ihren Termen erläutert
und mit Kurzzeichen versehen; doch leider werden diese später im Text
nicht mehr aufgegriffen, sondern immer wieder durch andere Symbole
ersetzt, je nachdem, welcher Veröffentlichung eine Tabelle oder
Abbildung entnommen wurde.
Der Versuch, die globalen Strahlungs- und Wärmeflüsse der Atmosphäre
in Fig. 7.1 darzustellen, muss als nicht geglückt bezeichnet werden,
da die Vielzahl der Verbindungslinien zwischen den Einnahmen und
Ausgaben, den lang- und kurzwelligen Strahlungsströmen sowie den
turbulenten Flüssen die Abbildung schwer lesbar macht. Auch liegt für
die nachfolgenden Abbildungen (Fig. 7.2) keine Stringenz in der
Verwendung von Symbolbezeichnungen für die Strahlungsbilanzglieder,
für die Wärmeströme (Fig. 7.3; Angabe hier in J/(cm2·d) sowie für die
Darstellung der Klimazonen abhängigen Strahlungsbilanz für
repräsentative Stationen (Fig. 7.4, hier sogar in cal/(cm2·h)
zugrunde. In Kapitel 8 (“Tages- und Jahresgänge der Energiebilanz an
der Erdoberfläche”) werden sehr informativ die Komponenten der
Energiebilanz anhand von Tagesgängen für verschiedene Oberflächen in
unterschiedlichen Klimazonen dargestellt (Fig. 8.1). Der Vergleich der
Werte für den tropischen Atlantischen Ozean zwischen einem windstillen
und windreichen Tag belegt den Einfluss der Turbulenz auf die latente
Wärmestromdichte. Während diese beiWindstille kaum auftritt (fehlendes
Sättigungsdefizit der Luft, stabil geschichtete Atmosphäre, geringer
turbulenter Austausch/Transport) und der größte Teil der Energie als
Speicherterm in die Wassersäule gelangt, wird bei windreicher
Wetterlage ein wesentlich größerer Teil der Energie in latente Wärme
umgesetzt und deutlich weniger in den Speicherterm
abgeführt. Bedauerlicherweise wird hinsichtlich der richtunggebenden
Vorzeichen keine Einheitlichkeit gewahrt, denn in Fig. 8.1 werden von
der Oberfläche weggerichtete Flüsse mit einem negativen Vorzeichen
versehen, eine Abbildung später (Fig. 8.2) wird jedoch genau umgekehrt
verfahren. Hier sollte eine einheitliche Konvention bevorzugt werden.
Kapitel 9 (“Lufttemperatur und Temperaturverteilung in der
Atmosphäre”) referiert neben den Messmethoden zur Erfassung der
Lufttemperatur die regionale Differenzierung in Tages- und Jahresgänge
(dargestellt durch repräsentative Thermoisoplethendiagramme) sowie die
vertikale und horizontale Verteilung der Lufttemperatur anhand
verschiedener klimageographischer Beispiele.
Mit Kapitel 10 (“Der Luftdruck, seine Messung und Darstellung”)
schließt sich ein kurzer Abschnitt über die Druckverhältnisse und ihre
Berechnungsmöglichkeiten in der Atmosphäre an. In Kap. 10.1 ist die
Einheit des Druckes leider falsch angegeben (nicht Nm2, sondern
Nm-2). Auch wird für die Schwerebeschleunigung g eingeführt, g*, das
ebenfalls verwendet wird, jedoch nicht.
In Kapitel 11 (“Horizontale Luftdruckunterschiede und die Entstehung
von Wind”) werden einfache Zirkulationssysteme zur Herleitung der
horizontalen Luftbewegung beschrieben und sämtliche auf ein
Luftvolumen wirkende Kräfte behandelt. Zu Beginn des Kapitels wird
darauf hingewiesen, dass Wind eine vektorielle Größe darstellt. Hier
hätte es sich angeboten, bei der späteren Behandlung der Kräfte auf
ein Luftvolumen die vektorielle Schreibweise in der Formelsprache auch
darzustellen. Ferner sollte Corioliskraft nicht mit
Coriolisbeschleunigung gleichgesetzt werden (S. 142). Logisch wäre es,
mit Kapitel 13 über die vertikalen Luftbewegungen anzuschließen und
dann Kapitel 15 über die Allgemeine Zirkulation folgen zu
lassen. Stattdessen wird mit Kapitel 12 (“Der Wasserdampf in der
Atmosphäre”) auf die Luftfeuchtigkeit, ihre Messung und geographische
Verteilung eingegangen. Etwas ungewöhnlich ist bei der Angabe der
Umwandlungsenergien bei Aggregatzustandswechseln von Wasser (Tabelle
S. 166; Tabellennummerierung fehlt, an anderen Stellen gelegentlich
auch) der Begriff “Depositionswärme” (Übergang Wasserdampf ! Eis)
anstelle von Sublimationswärme (Re- oder auch Retrosublimation). Bei
der Behandlung von Messmethoden sollten nicht nur die altbekannten
Verfahren (Haarharfen, Psychrometer) genannt werden, sondern auch auf
neue Möglichkeiten zur Erfassung des Wasserdampfes in der Atmosphäre,
wie Impedanz-Hygrometer, Kapazitätsfeuchtefühler oder FTIR-Verfahren
hingewiesen werden.
Kapitel 13 (“Vertikale Luftbewegungen und ihre Konsequenzen”)
beschäftigt sich mit dem atmosphärischen Austausch. Der Abschnitt über
die dynamische und thermische Turbulenz muss als nicht mehr zeitgemäß
angesehen werden, denn in den Abschnitten zur Turbulenz wird diese
ausschließlich am Austauschkoeffizienten festgemacht. Zwar werden
dynamische und thermische Turbulenz ausführlich erläutert, jedoch
keine Bezüge und Erläuterungen zu den direkten und indirekten
Erfassungsmethoden vertikaler Transporte (Gradient-, Eddy-
Kovarianz-Verfahren etc.) vorgenommen. Bei der adiabatischen
Zustandsänderung von Gasen wäre es angebracht gewesen, auf die
spezifische Gaskonstante für Luft, die sich bekanntlich aus den
spezifischen Wärmen für Luft berechnet (cp-cv = RL), hinzuweisen.
Kapitel 14 (“Wolken und Niederschlag”) widmet sich mit umfangreichem
Text der Kondensation, Sublimation und der Wolken- sowie
Niederschlagsbildung. Dabei werden zum Teil sehr genau die einzelnen
Wolkenarten beschrieben; hierbei wurde äußerst sparsam mit der
Verwendung von Abbildungen umgegangen. Eine Beschreibung der
geographischen Verteilung der Niederschläge beschließt dieses Kapitel.
Das mit 48 Seiten Umfang stärkste Kapitel ist Kapitel 15 (“Makroklima:
Die Allgemeine Zirkulation der Atmosphäre und die klimatische
Gliederung der Erde”). Hier wird die Allgemeine Zirkulation mit ihren
Einzelgliedern zuerst von der Seite der Dynamik der planetarischen
Höhenwestwindzone betrachtet. Dann werden die sich daraus für die
Zirkulation ergebenden Konsequenzen äußerst detailliert beschrieben,
sodass sich schon in dem ersten Teil dieses Kapitels die Frage nach
der Übersichtlichkeit stellt. Anschließend wird auf die planetarischen
Luftdruckgürtel im Meeresniveau eingegangen, bevor dem tropischen
Zirkulationsmechanismus insgesamt 21 Seiten gewidmet werden. Das
Kapitel endet mit einem zusammenfassenden Überblick (auch mit Hilfe
von Satellitenbildern) über die Zirkulationen in den unteren Schichten
der ektropischen Atmosphäre. Insgesamt gesehen wird hier eine Fülle an
Material verarbeitet und präsentiert, wobei immer interessante
geographische Bezüge hergestellt werden. Dieses Kapitel stellt sicher
das Kernstück dieses Lehrbuches dar. Für das Studium des an
Informationen sehr dichten Textes wären Lesehilfen durch
Texthervorhebungen leitender Gedanken in Fettdruck oder die
Auslagerung von Detailinformationen in Erläuterungskästen
hilfreich. Die häufig als “Konsequenzen” in kursiver Schrift den
Abschnittsenden als eine Art Zusammenfassung angefügten Textzeilen,
reichen dazu nach Meinung des Rezensenten nicht aus.
Im Vergleich zu den Vorgängerauflagen neu aufgenommen wurden die
Kapitel 16 (“Mesoklima: Stadt- und Geländeklima”) sowie Kapitel 17
(“Atmosphärische Gefahren”) und Kapitel 18 (“Der Klimawandel – das
größte Umweltproblem des 21. Jahrhunderts”). Kapitel 16 behandelt die
wichtigsten Charakteristika des Stadtklimas und geht – allerdings nur
sehr kurz – auf geländeklimatische Belange ein, für die als
mitteleuropäische Beispiele die im Wesentlichen von der
Reliefgestaltung abhängigen Strahlungsströme und Luftzirkulationen
gewählt wurden.
Kapitel 17 stellt einen sehr lesenswerten Überblick über die Unwetter
der letzten Jahre und deren Auswirkungen dar. Das abschließende
Kapitel 18 nimmt ausführlich zum Klimawandel Stellung.
Auf einige Inkonsequenzen, die eine Neubearbeitung eines im
Wesentlichen vorliegenden Textes offensichtlich mit sich bringen, muss
abschließend noch hingewiesen werden. Diese betreffen in erster Linie
die Handhabung von Einheiten der Größen Strahlungsstromdichten und
Energiesummen. Hier sollte eine Vereinheitlichung in W/m2,
kWh/(m2·Zeit) bzw. MJ/(m2·Zeit) angestrebt werden.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Überarbeitung
diesem Lehrbuch gut getan hat. Allerdings stellt sich auch hier die
grundsätzliche Frage, ob es nicht sinnvoller ist, ein Lehrbuch neu zu
verfassen als zu versuchen, einen vorliegenden älteren Text
umzuschreiben. Zwar wurde dieser von einem Altmeister der
Klimageographie verfasst, jedoch präferierte Wolfgang Weischet lange
Schachtelsätze mit hoher Informationsdichte, die gelegentlich den für
ein Einführungsbuch so wichtigen roten Faden nicht mehr erkennen
lassen. Unabhängig davon werden diejenigen das Buch gerne zur Hand
nehmen, die an detailliertem klimageographischem Wissen interessiert
sind.
Meteorologische Zeitschrift 18, 2009