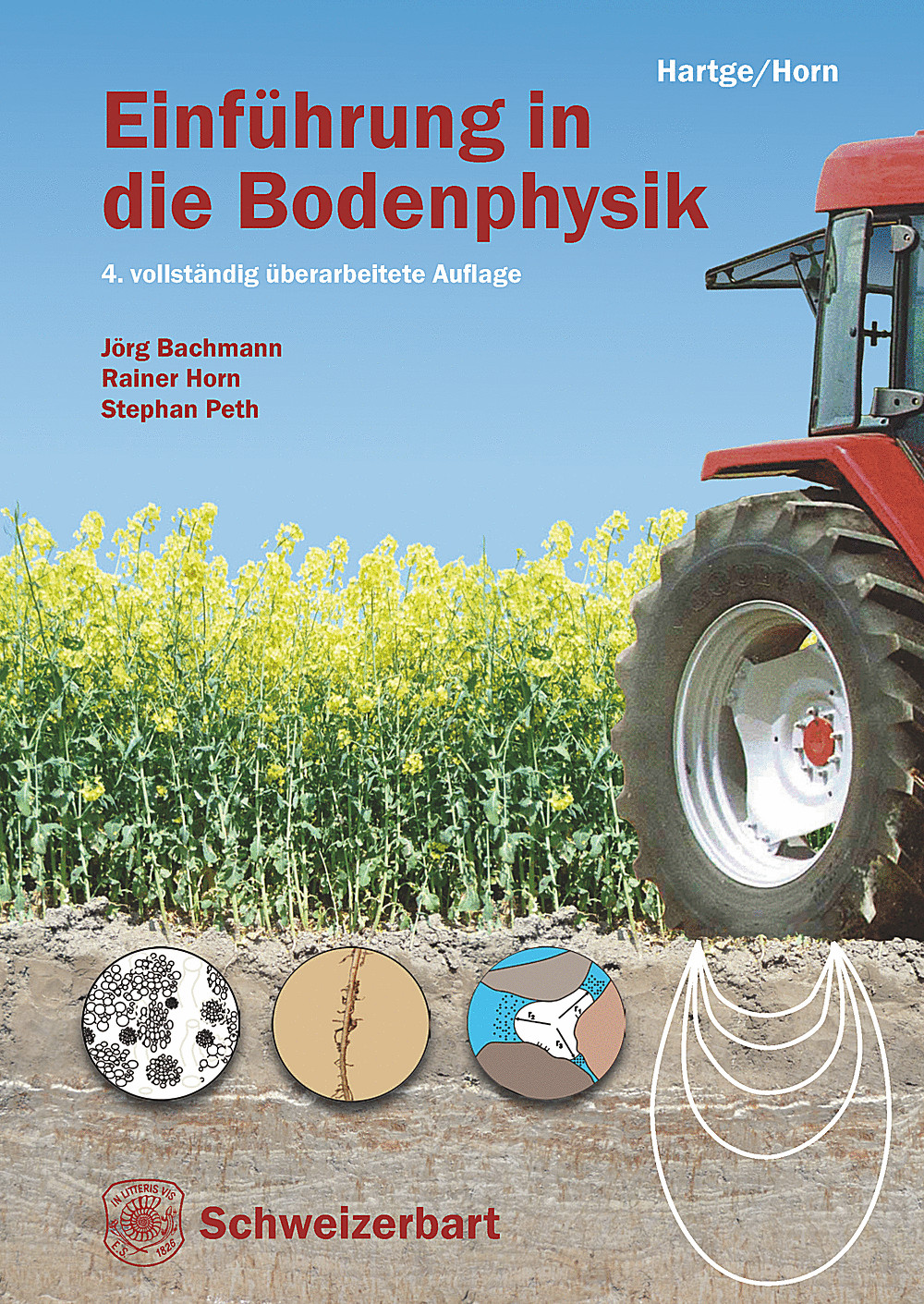Wenn ich waldpädagogische Führungen zum Thema Boden anbiete, ist eine
der letzten Fragen, die ich an die Teilnehmer richte, die folgende:
Was ist das Geheimnis von Böden? Oder anders formuliert: Was macht
Boden zu dem, was er ist und leistet? Meistens beantworten wir diese
Frage mit der Feststellung: seine große innere Oberfläche! Genau
diese, durch Körnung und Gefüge geschaffene Einheit von fest, flüssig
und gasförmig legen die drei Autoren, die das bekannte Lehrbuch der
Bodenkundler aus Hannover und Kiel von Hartge und Horn weitergeführt
haben, in den ersten beiden Kapiteln dar. Auch im weiteren Verlauf des
Buches bauen sie darauf auf, indem sie in Kapitel 3 die
mechanisch-hydraulischen Kräftesysteme, dann die Wechselwirkungen
zwischen Wasser und Boden, die Verbreitung und Hydrostatik des
Bodenwasser und die Wasserbewegungen erläutern und in Kapitel 7 um
Betrachtungen zur Gasphase im Boden ergänzen. Dass von Körnung und
Gefüge ganz wesentlich das thermische Verhalten, der Wasser-, Wärme-
und Gashaushalt des Bodens und als Ergebnis daraus der Boden als
Pflanzenstandort abhängen, leuchtet unmittelbar ein und wird
dankenswerterweise im vorliegenden Buch ausführlich besprochen. Auch
auf weitere Fragen meiner waldpädagogischen Laienführung werden
wissenschaftliche Antworten gegeben: „Wovor hat der Boden Angst?“
(Physik der Erosion, Kapitel 11) und „Was macht der Boden beruflich?"
(Lösungstransport und Filterprozesse, Kapitel 12).
Auf 321 Seiten geht es also um die Physik des Bodens, die den Lesenden
mit einer wunderbaren Mischung aus mathematischen sowie verbalen
Erklärungen verständlich gemacht wird. 22 Seiten Literaturverzeichnis
bieten Interessierten an, noch tiefer einzusteigen. Kapitel 15
(„Häufige Maßeinheiten und Umrechnungen“) schließlich hilft allen,
denen der Zusammenhang von Pascal und bar nicht mehr so geläufig ist.
Insgesamt kann das Buch nur vorbehaltlos empfohlen werden, denn in
allen Abschnitten wird nicht nur gesagt, dass etwas ist, wie es ist,
sondern es wird das Warum geklärt. (So wird selbst die Frage
beantwortet, warum die Korngrößenklassen so sonderbare Grenzen haben.)
Schön ist zudem, dass auch die bisherigen Schwächen der Bodenphysik,
wie z. B. der häufige Ausschluss der organischen Substanz, offen
angesprochen sowie Perspektiven weiterer Forschungen aufgezeigt
werden.
Einfache, gut erklärende Skizzen und viele Tabellen und Diagramme
lockern den Text auf. Wie nah an den Lesenden die Autoren formulieren
können, soll an folgenden Beispielen demonstriert werden: Die mit
Studierenden immer wieder diskutierte Erscheinung der Hysterese der
pF-Kurve wird einfach zusammengefasst: „Außerdem erkennt man, dass der
Meniskus bei Be- und Entwässerung nicht an denselben Engpässen Halt
machen würde.“ Der abschließende Satz zur Thixotropie macht das
Einordnen in den Alltag leichter: „Vereinfacht heißt das, solange man
eine thixotrope Flüssigkeit umrührt, ist sie dünnflüssiger als
vorher.“
Ein Genuss für mich als Bodenkundlerin waren Abschnitte wie z. B. der
über die „Auswirkungen von Tierbewegungen und Pflanzenwuchs“, die im
Detail erklären, wie genau Regenwürmer und Pflanzenwurzeln durch den
Boden gelangen, oder das Kapitel über die Evaporation, das einem ein
Auflagehumuspaket mit L-, Of- und Oh-Lage als annähernd idealen
Verdunstungsverminderer erscheinen lässt.
Lediglich in einigen Fällen muss man gewisse Passagen zweimal lesen,
um sie zu verstehen, und manchmal hätte man sich noch ein paar
zusätzliche Informationen zu den knappen physikalischen Details
gewünscht, zum Beispiel ausführlichere Erläuterungen zu Drücken und
Spannungen im Boden. Der Titel des Buches „Einführung in die
Bodenphysik“ erscheint an solchen Stellen etwas untertrieben. Auch
sind die Kapitel ganz offenbar nicht für rasches Nachschlagen
geschrieben, denn eines baut auf den anderen gerade auch bei den
Begrifflichkeiten auf. Gelegentlich wird in einem früheren Abschnitt
auch in ein Thema eingeführt, das erst später ausführlich besprochen
wird. So werden z. B. schon auf Seite 68 die Kenngrößen des
Darcy-Gesetzes als Erklärung für das durch die Primärsetzung
austretende Wasser herangezogen, obwohl dieses Gesetz erst in Kapitel
4 und v. a. in Kapitel 6 behandelt wird. Solche kleineren
Inkonsistenzen sind vermutlich der Bearbeitung der einzelnen Kapitel
durch jeweils einen der drei Autoren geschuldet. Leider enthält das
Buch kein Glossar, in dem man Begriffe und ihre Definitionen –
„Schlupf“, „Schubspannung“, „Quickerde“ oder „träge Masse“ – nachsehen
könnte. Ein letzter kleiner Kritikpunkt, zumindest in dem mir
vorliegenden Exemplar, ist die nur mittelmäßige drucktechnische
Ausführung, die dazu führt, dass einige Seiten wegen
Doppelbeschriftung kaum zu lesen sind.
Alles in allem ist „Einführung in die Bodenphysik“ ein außergewöhnlich
gutes Lehrbuch, dem man die lange Reifung seit seiner ersten Auflage
im Jahr 1978 bis zur heutigen 4. Auflage und die vielfältige Erprobung
im Universitätsalltag überaus positiv anmerkt.
Sabine Ammer, Göttingen
forstarchiv 85, Heft 5 (2014), 169