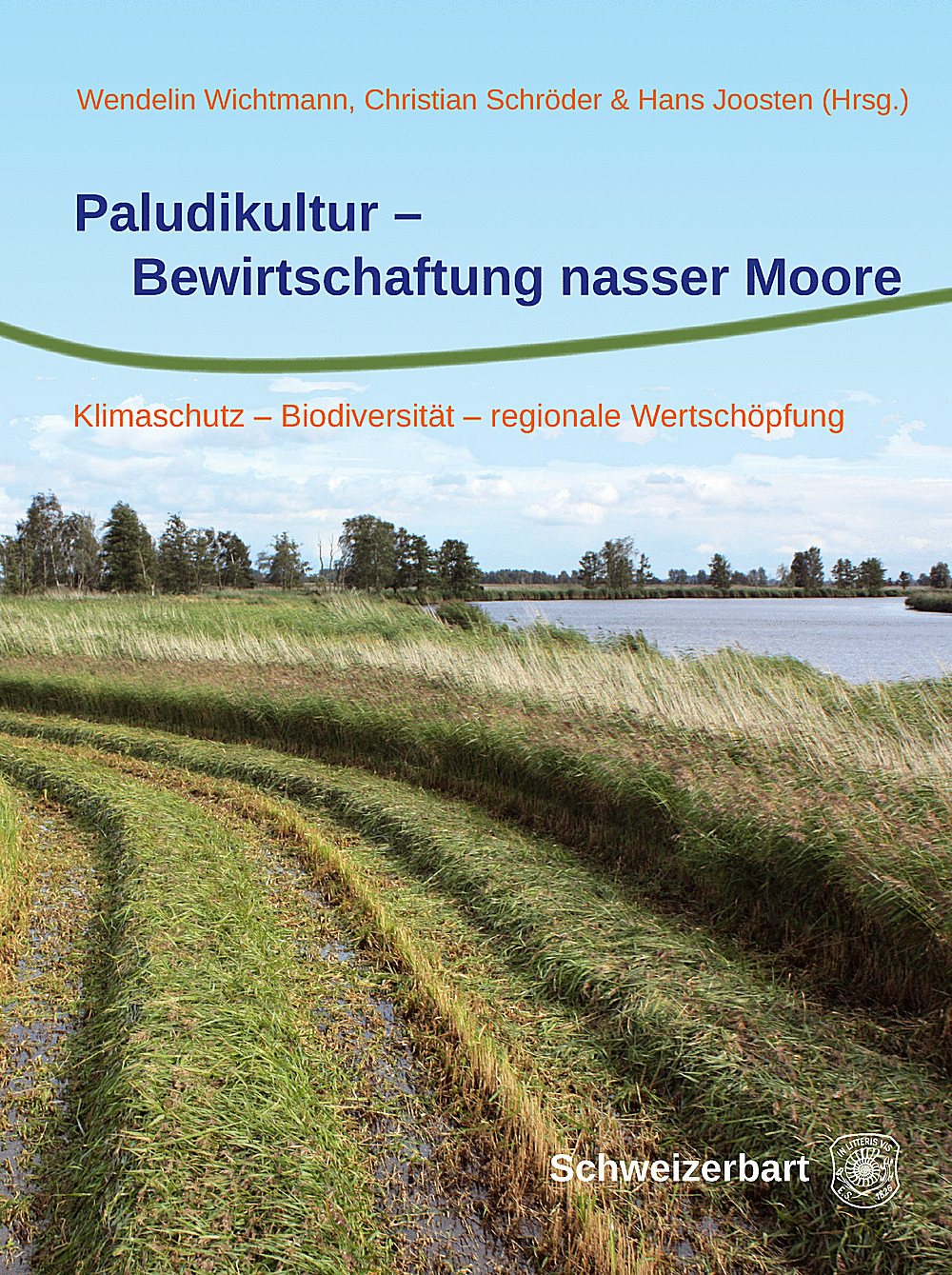„Moore in Verantwortung nutzen“ – unter diesem Leitgedanken steht das
Buch, das der Paludikultur gewidmet ist. Der neue Begriff wurde erst
vor etwa 10 Jahren geprägt, um einen neuen Ansatz im Umgang mit
ehemaligen Torfmooren (nach ihrer tiefgründigen Entwässerung und
nachfolgender konventioneller agrarischer Nutzung) zu benennen. Ziel
dieser neuen Moornachfolgenutzung ist es, den nach der bisherigen
Torfkultur noch verbliebenen Kohlenstoffvorrat zu erhalten und sogar
in gewissem Umfang durch neuartige Weiterbewirtschaftung neu
aufzubauen – mit Hilfe produktiver, möglichst torfaufbauender
Phytocoenosen.
Es ist ein „Teufelskreis“: Durch den Torfabbau nach Entwässerung
wird der gespeicherte Kohlenstoff zum Treibhausgas CO2
veratmet. Der Moorkörper „schwindet“, gerät wieder in den
Grundwasserbereich und muss erneut und immer tiefer entwässert werden,
um weiter konventionell bewirtschaftet werden zu können. Durch
Wiedervernässung lässt sich die Abstiegsspirale unterbrechen:
Paludikultur wäre eine integrative Systemlösung für dieses Problem.
Paludikultur ist aber nur begrenzt als Reparaturanweisung für Moore
anwendbar. Allerdings lassen sich einige Ökosystemdienstleistungen
intakter Moore „revitalisieren“: auf dem Gebiet der
Gewässerregulierung, des Klimaschutzes, der biologischen
Vielfalt. Aber auch eine weitere sinnvolle wirtschaftliche Nutzung
bleibt erhalten: Eine Vielzahl von Pflanzenarten können unter nassen
Bedingungen gewinnbringend angebaut werden. Als wichtigste
Handlungsrichtlinie bei allen Eingriffen in Moorkörper muss indes
gefordert werden: “Eine genaue Zieldefinition sowie Abschätzung der
naturschutzfachlichen Konsequenzen sind daher vor der Etablierung
jeglicher Managementmaßnahmen unumgänglich“(S. 94).
Keinesfalls ist Paludikultur ein Konzept, das den Anspruch erhebt,
degradierte Moore wieder zu ihrem ursprünglichen Zustand zu
„renaturieren“. Dass eine vollkommene Regeneration unmöglich ist,
steht beim Autorenteam aus erfahrenen Moor- und Agrarwissenschaftlern
mit langer Praxiserfahrung außer Frage. Paludikultur könnte allenfalls
erwogen werden als „Nutzungsalternative für naturnahe Moore, die
aufgrund des Flächendrucks von Entwässerung bedroht sind“. „Die
Inkulturnahme natürlicher Moore sollte – aufgrund ihrer vielen
komplexen Ökosystemdienstleistungen – möglichst vollständig
unterbleiben. Ist eine Nutzungsaufnahme unabwendbar, ist Paludikultur
in jedem Fall einer Entwässerung vorzuziehen“.
Der Betrachtungshorizont der Autoren ist weltweit ausgespannt und
beschränkt sich nicht nur auf Reparaturmaßnahmen in Mitteleuropa. Hier
sollte Moorschutz eigentlich selbstverständlich geworden sein. Dennoch
gibt es auch in Deutschland kein verbindliches Moorschutzprogramm,
allenfalls Positionspapiere und Absichtserklärungen, z. B. auch in der
Nationalen Biodiversitäts-Strategie Deutschlands.
Mehrere Kapitel befassen sich mit umweltrelevanten chemischen
Prozessen in Mooren und bei der Ent- und Wiedervernässung. Natürliche
Moore sind klimaneutral bei Berücksichtigung „kurzer“
Beobachtungszeiträume – 100 Jahre. Beim Blick auf längere Zeiträume –
500 Jahre – überwiegt die Kohlenstoff-Fixierung über die Emission von
Treibhausgasen, hat also “kühlenden“ Effekt auf das globale
Klima. Diese langen Zeiträume, die über alle menschlichen
Planungshorizonte hinausgehen und deshalb nicht überschaubar sind,
sollten bei allen Überlegungen zu heutigen Eingriffen in Moore bedacht
werden.
Entwässerte Moore emittieren 2 - 3 Gt CO2 pro Jahr. Durch
Wiedervernässung wird die CO 2 -Emission stark reduziert, aber es
entstehen keine großen CO2-Senken.
Die CH4 -Emission nimmt stark zu, in der Größenordnung
vergleichbar mit natürlichen Mooren. Einstau nur bis zur
Geländeoberkante senkt die NH4-Emission, Überstau kann sie
stark erhöhen. Die Variationsbreite ist erheblich. Die
N2O-Emission, ggf. auch -Aufnahme, ist gering.
Die Randbedingungen und Konsequenzen der konventionellen Moornutzung
und nachfolgender Degradation sind alarmierend, bezogen auf
Deutschland wie auch weltweit. In Deutschland gibt es 1,3
Mill. ha. Moorböden, davon werden 68 % landwirtschaftlich genutzt, das
sind 6 % der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche. Dieser kleine
Flächenanteil emittieret aber 99 % der Gesamtemission an
Treibhausgasen aus landwirtschaftlichen Böden (41 Mill t
CO2-Äq), entsprechend 4,3 % der Gesamtemission an
Treibhausgasen.
Auch wenn Baden-Württemberg nicht so großflächig (gesamte Moorfläche
hier ~40.000 ha) von Mooren bedeckt wurde wie der norddeutsche Raum,
erfolgten in Oberschwaben großflächige Moorentwässerung und
nachfolgend Moormineralisierung, die markant Landschaftsstruktur,
Landnutzung und Standorte veränderten. Untersuchungen des Landesamts
für Geologie, Rohstoffe und Bergbau im Regierungspräsidium Freiburg
(LGRB; Weinzierl u. Waldmann 2015) ergeben für den Zeitraum 1949-1974
eine Absenkung der Mooroberfläche von 3-8 mm/Jahr, aus der eine
jährliche CO2-Emission von 0,6 Mio. t berechnet wurde. Die
Vorräte betragen 34,1 Mio. t Corg (potenziell einer
Emission von 125 Mio. t. CO2- entsprechend) . Bei
unveränderter Weiternutzung könnten bis 2055 6.300 ha Moorboden
verschwinden, bis 2100 sogar 11.400 ha.
Schätzungen zufolge sind weltweit 4.5 Mill km2 (3 % der globalen
Erdoberfläche) von Mooren bedeckt; 15 % davon werden genutzt,
entsprechend 0,45 % der globalen Erdober fläche), die aber 5,5 % zur
anthropogenen CO2 -Immission beitragen. Der gesamte
weltweit in Mooren gespeicherte Kohlenstoffvorrat entspricht der
gesamten terrestrischen Biomasse – kaum vorstellbar, welche
Konsequenzen daraus für die Erdatmosphäre entstehen könnten, würden
sie metabolisiert. Zahlreiche weitere statistische Daten sind
zusammengestellt.
Das Abschlusskapitel fasst die Botschaft des Buches in drastischen
Worten zusammen und kehrt zum Ausgangspunkt zurück: Der Weg aus der
Wüste – Lösungen. Moore wurden in steppenähnliche Systeme umgewandelt,
günstig für den Anbau meist annueller Pflanzen. In Steppen und
Halbwüsten liegt der Ursprung der Landwirtschaft, deshalb ist es
nachvollziehbar, dass für agrarische Nutzung solche Landschaftstypen
erstrebenswert sind. Nach Aufbrauchen der Torfkörper verlieren die
ehemaligen Torfböden aber ihre Funktion als Produktionsgrundlage. „Das
ist gewissermaßen vergleichbar mit dem Verlust der Böden in heißen
Klimaten durch Desertifikation“ (Michael Succow im Geleitwort). Eine
dauerhafte Bewirtschaftung ist aber nur unter permanent nassen
Bedingungen möglich: Paludikultur ist die Lösung des Problems, es sei
denn, man kann sich nach dem Ende der bisherigen natürlichen
Landschaftsstruktur noch ein landwirtschaftliches Nutzsystem in einer
dann degradierten – oder technologisch „optimierten“? – Landschaft
vorstellen, in dem es kaum mehr Moor-/Torfreste in humiden Moorsenken
gibt.
Das Buch ist ein engagiertes Plädoyer für die Erhaltung von Mooren und
einer nachhaltigen Moorkultur durch neuartige
Bewirtschaftungsansätze. Es liefert fundierte Informationen und
Statistiken zur weltweiten Moornutzung. Es vermittelt gut
verständlich und lesbar den Wissensstand über Stoffwechselvorgänge in
intakten und in Nutzung genommenen Mooren sowie deren Auswirkungen auf
die lokale und globale Umwelt. Ein sehr umfangreiches kumulatives
Literaturverzeichnis (27 Seiten) und ein detailliertes
Stichwortverzeichnis erleichtern die Lektüre. Die Motivations- und
Koordinationsleistung des Herausgebertrios für 73 Autoren verdient
Bewunderung. Ein wichtiger Beitrag zu den Grundlagen der Moorkunde und
zur Moornutzung, gerade in der aktuellen Diskussion um Moorschutz.
Winfried Bücking
standort.wald 50 (2018)