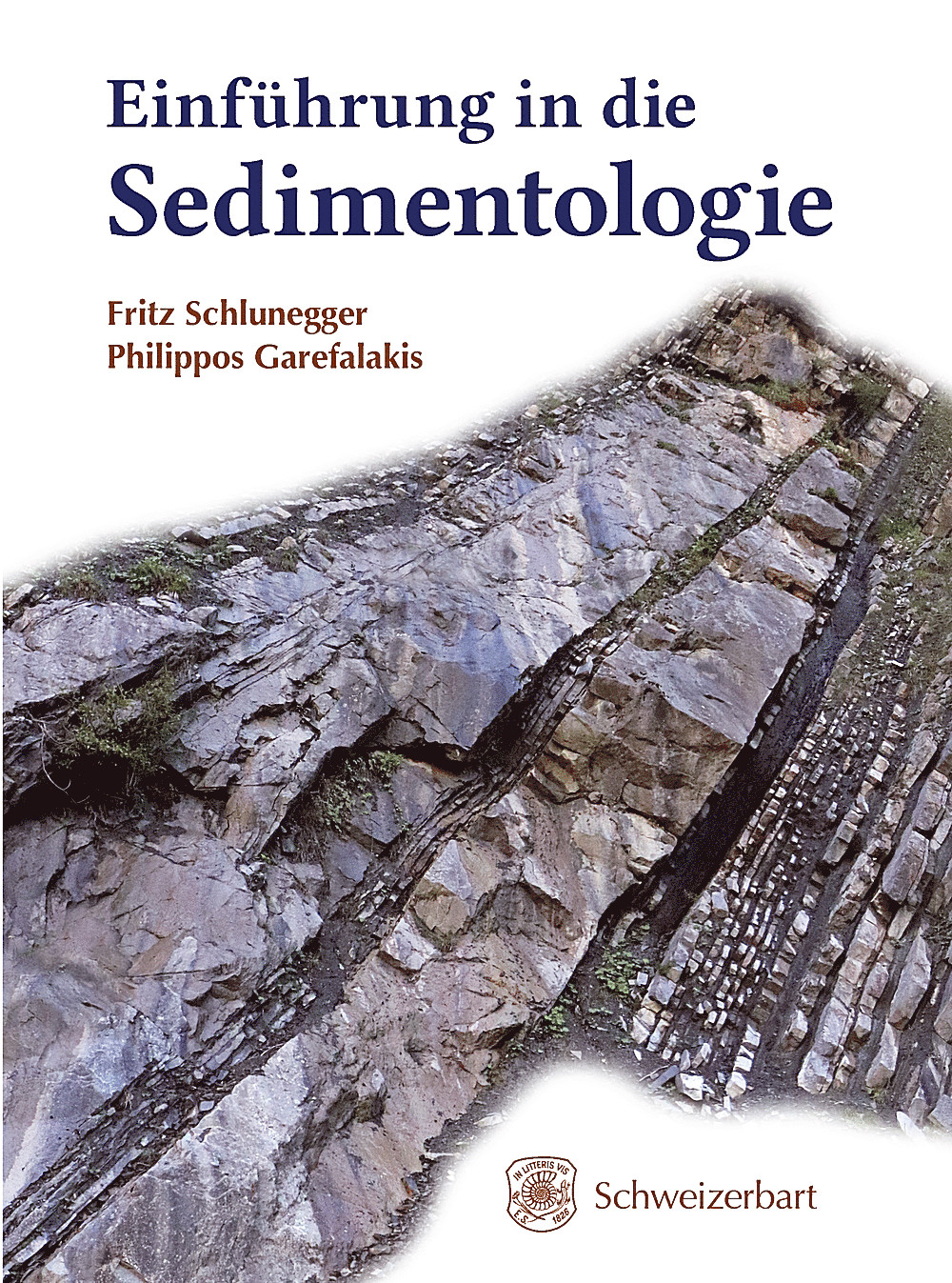1 Kreislauf der Gesteine und Nomenklatorisches 171.1 Kreislauf der Gesteine in der Übersicht 17
1.2 Vom Ursprung der Sedimentpartikel bis zu ihrer Ablagerung 19
1.2.1 Verwitterung und Bodenbildung 19
1.2.2 Erosion und Bildung von Sedimentpartikeln im Gebirge 19
1.2.3 Transport und Ablagerung der Sedimentpartikel im Flachland 21
1.2.4 Prozesse an der Küste 22
1.2.5 Transport zum Kontinentalfuß und Ablagerungen auf der Tiefsee-Ebene 22
1.2.6 Bildung von Kalksteinen 22
1.3 Klassifikationen der Sedimentpartikel und Sedimentgesteine 23
1.3.1 Klassifikation nach Korngröße 23
1.3.2 Klassifikation der Sandsteine nach mineralogischer Zusammensetzung 25
1.3.3 Klassifikation der Kalksteine im Hinblick auf die Energie im Ablagerungsraum 25
1.3.4 Klassifikation der Kalksteine nach Art der Körner 26
1.4 Größenverteilung, Gradierung, Rundung und Sortierung von Sedimentkörnern 27
1.5 Von der Lamina zu den Schichtformen 30
1.6 Vom Sedimentkorn zu Schichtsequenzen: Darstellung sedimentologischer Beobachtungen 32
1.7 Struktur und Gefüge 35
2 Entstehung von Sedimentpartikeln und Bodenbildung 37
2.1 Mechanische Verwitterung 37
2.2 Chemische Verwitterung 39
2.3 Verwitterung und Bodenbildung 42
2.4 Klima, Böden und Erosion – eine globale Perspektive 44
3 Gletscher, Massenbewegungen und vulkanische Ausbrüche 49
3.1 Gletscher – ihre Bildung und Bewegung 50
3.1.1 Erosion und Sedimentproduktion durch Gletscher 51
3.1.2 Gletscher und ihre Ablagerungen 52
3.2 Massenbewegungen 53
3.2.1 Sturzprozesse 54
3.2.2 Rutschungen 55
3.2.3 Schutt- und Schlammströme, Hangkriechen und Solifluktion 57
3.3 Vulkane und ihre Ablagerungen 60
3.3.1 Die Entstehung einer Vulkaneruption 60
3.3.2 Abfolge von vulkanischen Prozessen 61
3.3.3 Erste Prozesskette 62
3.3.4 Zweite Prozesskette 65
3.3.5 Datierung von Schichten und Massensterben wegen Vulkanausbrüchen 66
4 Sedimenttransport durch Wasser 69
4.1 Fließen von Wasser 69
4.1.1 Fließgeschwindigkeit 69
4.1.2 Laminares und turbulentes Fließen 70
4.1.3 Unteres und Oberes Fließregime 72
4.2 Gerichtete Strömung und Sedimenttransport 75
4.2.1 Der Widerstand des Untergrundes und das Stokes Gesetz 75
4.2.2 Mechanismen des Sedimenttransportes: Schwebend (Suspension), springend/hüpfend (Saltation) und rollend/gleitend 78
4.2.3 Transport von Ton- und Siltpartikeln: Schwebend bei laminarem Fließen 78
4.2.4 Transport von Sandkörnern: Saltierend bei turbulentem Fließen 80
4.2.5 Transport von Kies und Steinen: Rollend und schleppend bei turbulentem Fließen 80
4.2.6 Das Hjulström-Diagramm: Korngrößen-abhängiger Sedimenttransport im Überblick 83
4.3 Gerichtete Strömung und Ablagerung von Sediment 84
4.3.1 Tonpartikel: Ablagerung als feinlaminierte Lagen 86
4.3.2 Siltpartikel: Ablagerung als Kletterrippel 89
4.3.3 Sandpartikel: Bildung von Schichtformen und Sedimentstrukturen in Abhängigkeit vom Fließregime 89
4.3.4 Kies und Steine: Ablagerung im unteren und oberen Fließregime 92
4.4 Wellen 92
4.4.1 Eigenschaften von Wellen 92
4.4.2 Wellenbasis 96
4.4.3 Windseewellen, und Bildung von Wellenrippeln 97
4.4.4 Stürme und Bildung von Tempestiten 100
5 Flüsse, Seen und äolische Dünenfelder 103
5.1 Sedimentologische und geomorphologische Gliederung des Flachlands 103
5.2 Schuttfächer, Schuttschürzen und Megaschuttfächer 104
5.2.1 Schuttfächer und Schuttschürzen 104
5.2.2 Megaschuttfächer 106
5.3 Charakterisierung einer Flusslandschaft 109
5.3.1 Rinnengürtel und Flussrinne 109
5.3.2 Uferwall 111
5.3.3 Durchbruchsfächer 112
5.3.4 Überschwemmungsebene 112
5.4 Flusstypen und kontrollierende Faktoren 113
5.5 Sedimentologische Eigenschaften der unterschiedlichen Flusstypen 115
5.5.1 Verwilderte Flüsse 115
5.5.2 Mäandrierende Flüsse 118
5.5.3 Gerade Flüsse 122
5.5.4 Anastomosierende Flüsse 122
5.5.5 Zusammenstellung der unterschiedlichen Flusstypen 125
5.6 Seen 126
5.6.1 Insolationsbedingte Stratifikation des Seewassers 126
5.6.2 Eintrag und Verteilung der Sedimente im See 128
5.6.3 Bildung von Seewarven 130
5.7 Winde und die Bildung von äolischen Dünen 132
5.7.1 Sedimenttransport durch Winde 133
5.7.2 Windablagerungen 134
6 Ablagerungen im flachen Meer 143
6.1 Bathymetrische Gliederung 143
6.2 Wellendominierte Küste 144
6.2.1 Wellen und ihre Bildung 144
6.2.2 Morphologische und sedimentologische Gliederung einer wellendominierten Küste 146
6.2.3 Sedimentologische Prozesse und resultierende Strukturen an einer wellendominierten Küste 149
6.2.4 Zusammenfassung der wichtigsten Charakteristika einer wellendominierten Küste 158
6.3 Gezeitendominierte Küste 159
6.3.1 Gezeiten und ihre Bildung 159
6.3.2 Morphologische und sedimentologische Gliederung einer gezeitendominierten Küste 161
6.3.3 Sedimentologische Prozesse und daraus resultierende Strukturen an einer gezeitendominierten Küste 163
6.3.4 Wichtigste Sedimentstrukturen, die auf Gezeitenprozesse zurückgeführt werden 170
6.4 Flussdominierte Küste und Bildung eines Deltas 170
6.4.1 Einführung und Prozesse 170
6.4.2 Allgemeiner Aufbau und Verlagerung eines Deltas 172
6.4.3 Sedimentologische Abfolge eines fluss-, wellen- und gezeitendomierten Deltas 174
6.4.4 Zusammenfassung: Wichtigste Charakteristika von Deltas 176
7 Trübeströme und Turbidite 179
7.1 Geomorphologische und sedimentologische Übersicht 179
7.2 Rutschungen am Kontinentalhang und die Bildung von submarinen Schuttschürzen am Kontinentalfuß 181
7.3 Trübeströme: Entstehung, Transport und Ablagerung 182
7.3.1 Entstehung 182
7.3.2 Trübeströme hoher und geringer Dichte 183
7.3.3 Anatomie eines Trübestroms 183
7.4 Dynamische Entwicklung eines Trübestroms 185
7.4.1 Ablagerung von Trübeströmen und Bildung von Turbiditen 185
7.4.2 Weitere Sedimentstrukturen 189
7.5 Großmaßstäbliche Ablagerungsräume: Vom Canyon zum submarinen Schuttfächer 192
7.5.1 Im Canyon 192
7.5.2 Auf dem submarinen Schuttfächer 193
7.5.3 Bildung mächtiger Wechsellagerungen auf dem submarinen Schuttfächer 196
7.6 Dynamik eines submarinen Schuttfächers und Bildung von Sequenzen 197
7.7 Radiale und axiale Transportsysteme 199
8 Auf der Tiefsee-Ebene 203
8.1 Die pelagischen Sedimente 204
8.1.1 Tiefseeton 204
8.1.2 Kalkiger Tiefseeschlamm und Bildung von Mikrit 204
8.1.3 Kieseliger Tiefseeschlamm 207
8.1.4 Zusammenfassung 210
8.2 Marine Strömungen und Nährstoffzirkulation 213
8.2.1 Die thermohaline Zirkulation 213
8.2.2 Die Kalk-Kompensationstiefe (CCD) 214
8.2.3 Ablandige Winde und Bildung einer Auftriebsströmung (,upwelling’) 216
8.3 Globale Verteilung der Sedimente auf der Tiefsee-Ebene 218
9 Flachmarine Kalksteine 221
9.1 Die Karbonatminerale und Kalkpartikel 223
9.1.1 Geochemie der Karbonatminerale 223
9.1.2 Komponenten in Kalksteinen 226
9.2 Die Kalkplattform 233
9.2.1 Am Plattformrand: Wachstum von Korallen und Bildung eines Riffs 236
9.2.2 Am Plattformfuß: Ablagerung von Brekzien und Kalziturbiditen 236
9.2.3 Auf der Plattformschwelle: Bildung von Großrippeln 237
9.2.4 In der Lagune: Kalkschlamm mit Bioklasten und Onkoiden 237
9.2.5 Im Intertidal: Gezeiten und Umlagerung von Kalkschlamm in Prielen 238
9.2.6 Vom Intertidal zum Supratidal: Bildung von Salz und Lebensraum für Cyanobakterien 239
9.3 Ablagerungsräume auf einer Kalkplattform in der Übersicht 239
9.4 Bildung von Dolomit zwischen dem oberen Intertidal und dem unteren Supratidal 241
9.5 Beispiele von Kalkplattformen 246
9.5.1 Die Bahamas als Beispiel für eine gezeitendominierte Kalkfabrik 246
9.5.2 Die Westküste des Roten Meers als Beispiel für eine wellendominierte Kalkfabrik 246
9.6 Karbonatplattform mit Eintrag klastischer Partikel vom Festland 247
9.7 Epikontinentale Kalkplattform und Kalkrampe 249
10 Evaporite: Wo Wasser verdunstet 253
10.1 Die Evaporitminerale 254
10.2 Meerwasser-Evaporite: Das Sabkha Modell 256
10.3 Kontinentale Evaporite 259
10.4 Offenmarine Evaporite 262
11 Von der Lithofazies zur Sequenz- und Zyklostratigraphie 265
11.1 Stratigraphie 266
11.1.1 Superposition, Konkordanz und Diskordanz 266
11.1.2 Lithostratigraphie, Lithofazies und sedimentäre Architekturelemente 266
11.1.3 Biostratigraphie 267
11.1.4 Chrono- und Magnetostratigraphie 267
11.2 Transgression und Regression 272
11.2.1 Bildung regressiver und transgressiver Sedimentabfolgen 272
11.2.2 Mechanismen, welche die Bildung transgressiver und regressiver Sedimentabfolgen steuern 272
11.2.3 Verhältnis zwischen Bildung von Ablagerungsraum und Sedimentzufuhr 274
11.3 Sequenzstratigraphie 275
11.3.1 Bildung von ‚Systems Tracts‘ 275
11.3.2 Sedimentologische Abfolge von ‚Systems Tracts‘ 278
11.3.3 Sequenzstratigraphische Analyse als Hilfsmittel zur Korrelation von Schichtsequenzen 279
11.4 Zyklen und Zyklostratigraphie 283
11.4.1 Allozyklen und Autozyklen 283
11.4.2 Wilson-Zyklen, Milanković-Zyklen und Gezeitenzyklen 283
11.4.3 Die Mittelpleistozäne Übergangsphase 286
Literaturverzeichnis 289
Abkürzungsverzeichnis 293
Stichwortverzeichnis 295