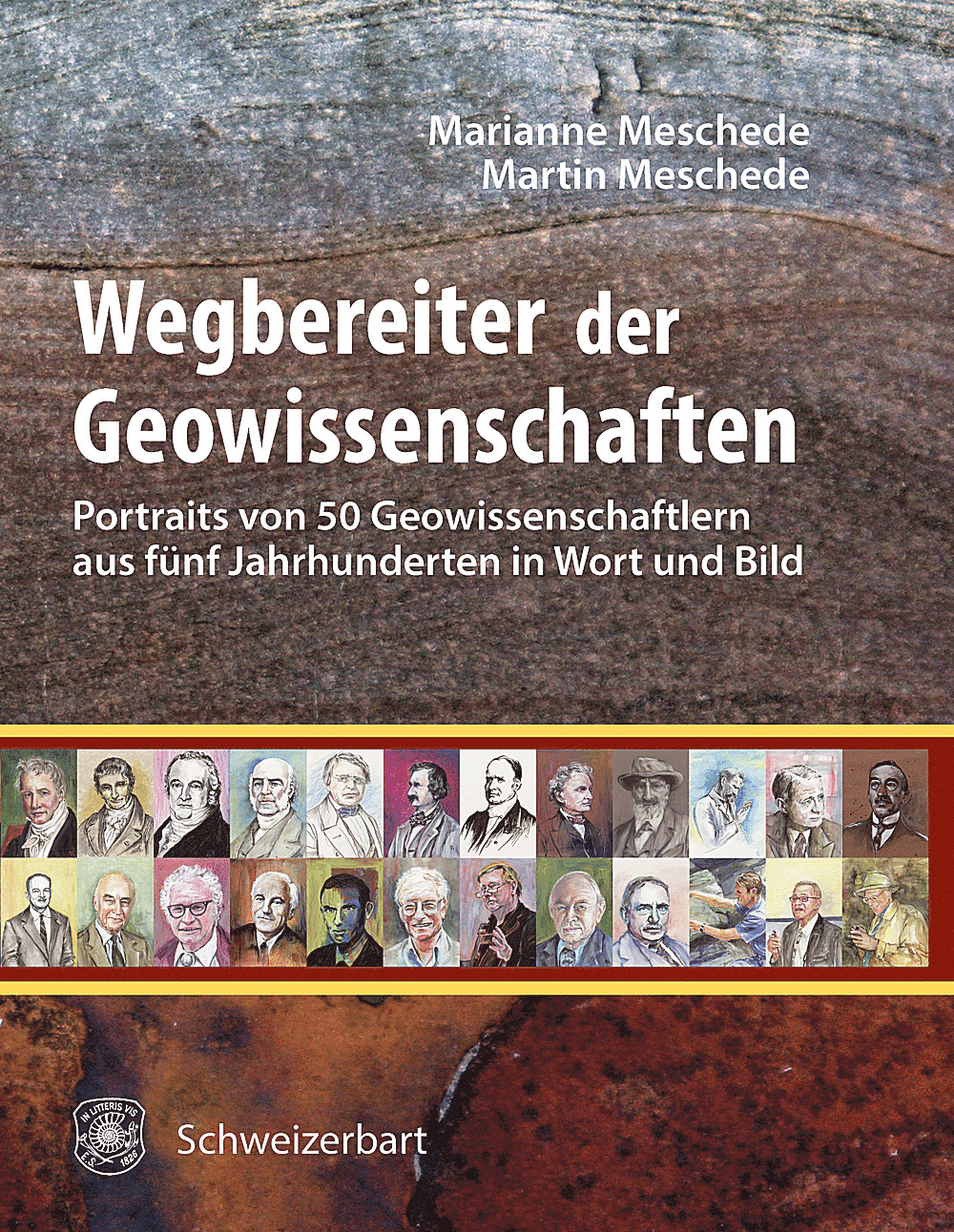Unser heutiges Verständnis vom Aufbau unserer Erde und des Lebens
basiert, wie auch in anderen Disziplinen, auf einer jahrhundertelangen
Erforschung. Zwar geriet man immer wieder einmal auch auf Irrwege und
in Sackgassen, aber neue Sichtweisen und Methoden brachten das Wissen
Schritt für Schritt voran. Aus einer fast unüberschaubaren Zahl an
Forschern ragen blitzgescheite Persönlichkeiten heraus, deren
Entdeckungen zumindest für ihre Zeit bahnbrechend waren. 50 davon
wurden von Marianne Meschede in verschiedenen Maltechniken
porträtiert. Ihr als Geowissenschaftler an der Universität Greifswald
tätiger Sohn lieferte dazu jeweils einen kurzen, sich weitgehend an
frei verfügbaren Quellen – wohl in erster Linie Wikipedia-Biografien –
orientierenden Abriss des jeweiligen Forscherlebens, auch mit privaten
Aspekten, und dessen Leistungen aus heutiger Sicht. Der Bogen spannt
sich von den „Vätern der Geologie“, wie Georgius Agricola und Nicolaus
Steno über Charles Darwin und Alfred Wegener bis zu noch lebenden
Personen, wie Walter Alvarez, einem der Entdecker der Iridium-Anomalie
an der Kreide-Tertiär-Grenze. Die Auswahl ist, wie könnte es auch
anders sein, subjektiv und fokussiert etwas auf plattentektonische
Aspekte, weswegen auch Geophysiker nicht zu kurz kommen. Beim
erstmaligen Durchblättern vermisste ich ein paar bedeutende
Paläontologen und Geologen des 19. Jahrhunderts, wie Heinrich Georg
Bronn, Karl Alfred von Zittel oder Melchior Neumayr. Andererseits
trifft man hier auch auf Persönlichkeiten, von denen ich selbst noch
kaum gehört geschweige denn gelesen habe, deren Leistungen aber
manchmal bis heute nachwirken. Deswegen ist dieses Buch nicht nur ein
„Lesebuch“ zum gemütlichen Schmökern, sondern erweitert tatsächlich
das Wissen zur Historie unserer Erdwissenschaften. Die nicht immer
geradlinigen Lebensläufe lassen keine Langeweile aufkommen. Manche
Forscher waren ihrer Zeit bereits weit voraus, andere verharrten in
überkommenen Ansichten und vermochten sich davon nicht zu
lösen. Auffällig ist auch, dass viele wichtige Erkenntnisse auf Reisen
gewonnen wurden – man denke nur an Darwin oder Alexander von
Humboldt. Friedrich August Quenstedt, der noch heute populäre
Jura-Geologe, ist freilich keineswegs der Erfinder des Schwarzen,
Braunen und Weißen Juras – diese Begriffe gehen vielmehr auf seinen
Mentor Leopold von Buch zurück, der hier ebenfalls gewürdigt wird. Der
kleine Fehler sei verziehen, findet er sich doch selbst in einer
dicken Monographie über den Jura von Helmut Hölder. Die nach
historischen Vorlagen, meist Fotografien, gestalteten Porträts
erfüllen die sonst eher abstrakt und unnahbar erscheinenden
Persönlichkeiten und Charakterköpfe mit frischem Leben, allerdings
wurde in einigen Fällen nach meinem Geschmack etwas zu viel „Rouge“
aufgetragen. Nach dem Lesen fragt man sich unwillkürlich, wer aus
unserer heutigen aktiven Forschergemeinde es wohl in ein solches Buch
schaffen würde. Sicher wäre der Frauenanteil darunter bedeutend
höher. Der Preis mag zwar etwas hoch erscheinen, doch stimmt die
Qualität.
Günter Schweigert
FOSSILIEN 6/2018, seite 61-62