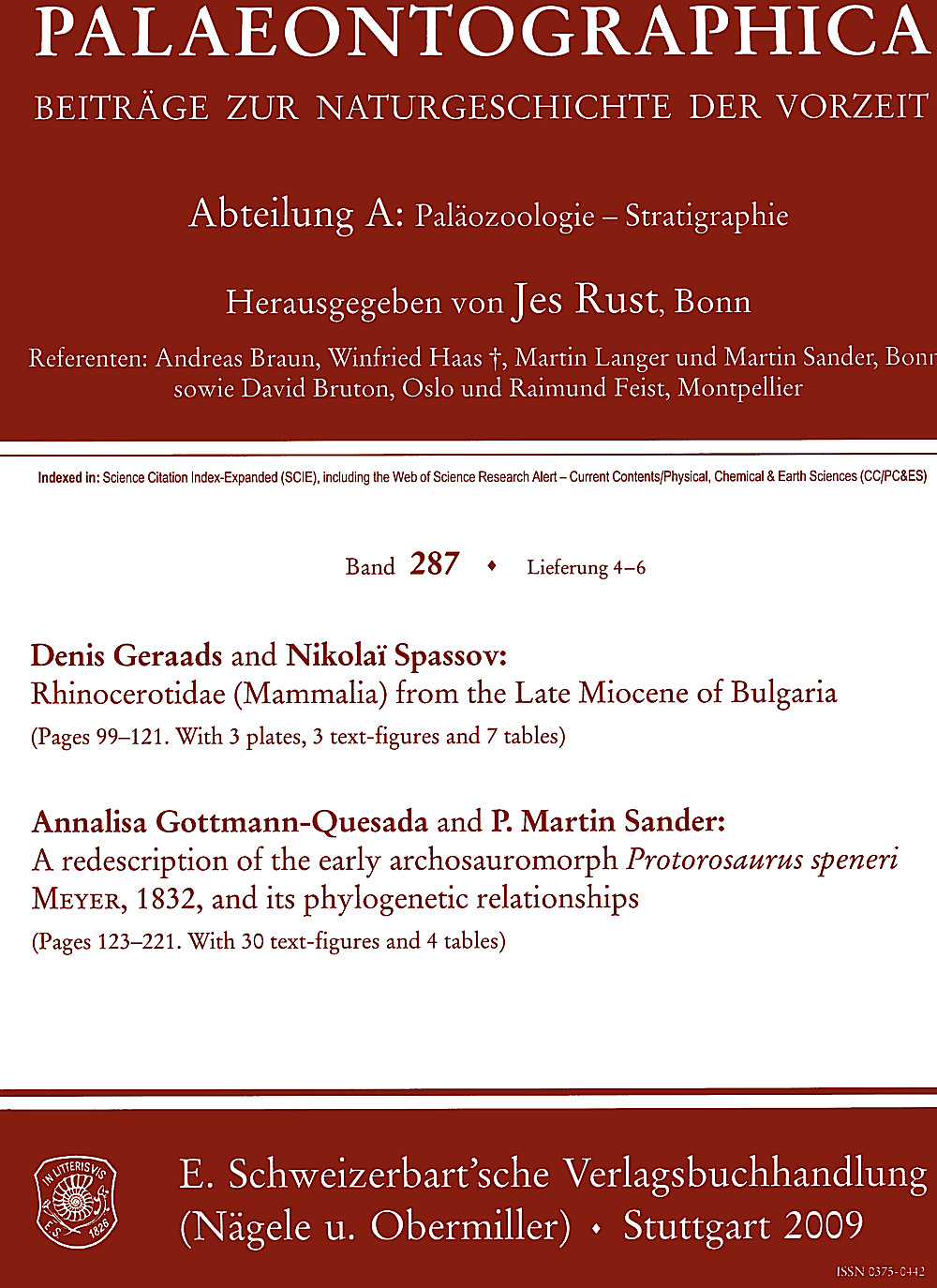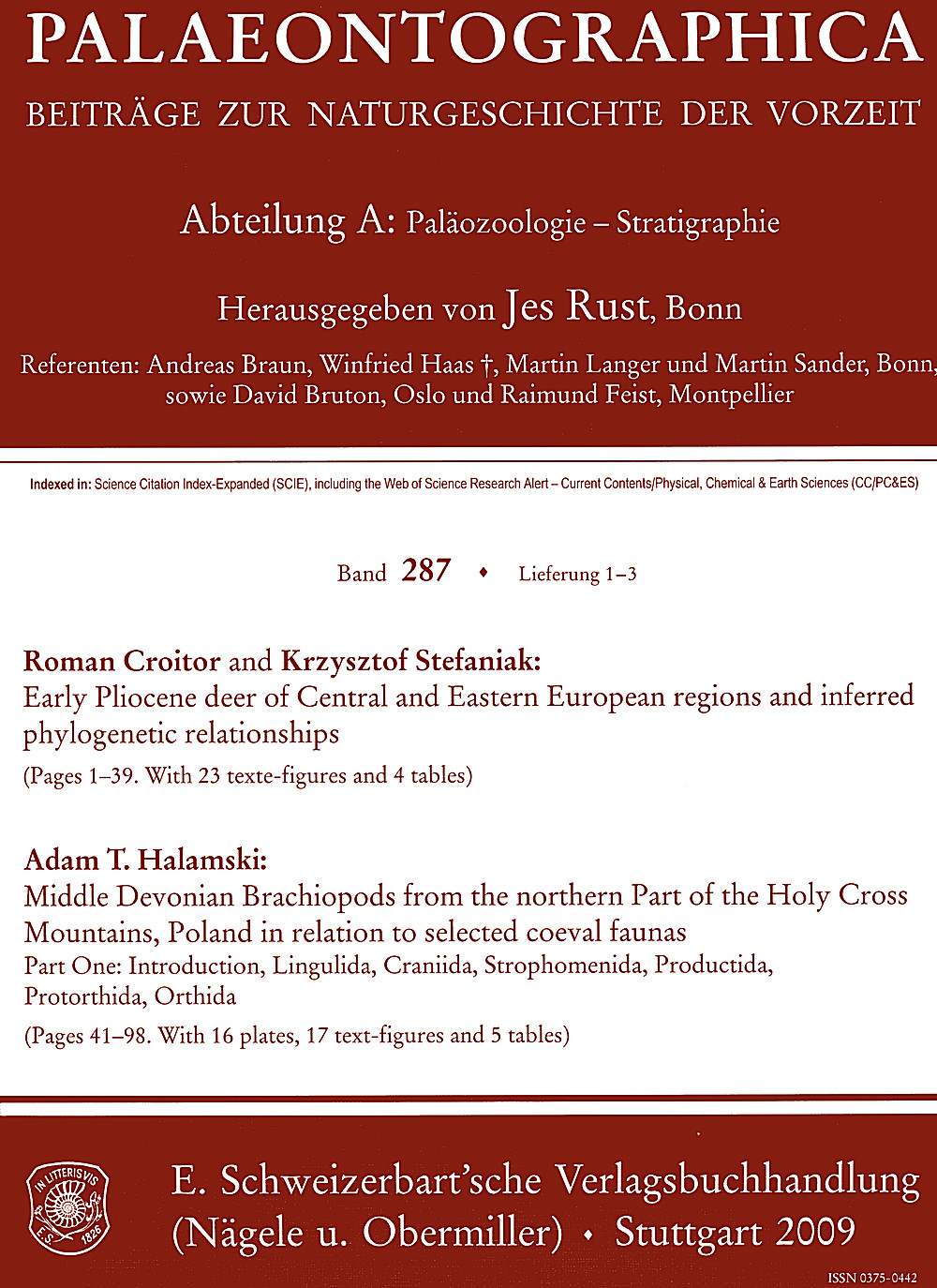Mit der Beschreibung eines Exemplars aus dem Kupferschiefer bei Kupfer
suhl im südwestlichen Thüringen durch C. M. SPENER im Jahre 1710 als
das Skelett eines metallisierten und fossilisierten Krokodils gehört
Protorosaurus speneri zu den ersten dokumentierten fossilen
Reptilien. Nachdem das Exemplar und weitere Funde Beachtung gefunden
hatten, erfolgte durch H. v. MEYER (1830 und 1832) die unverändert
gültige Benennung. In einer anschließenden Monographie berücksichtigte
dann v. MEYER (1856) 25 Exemplare. Die nach nun 150 Jahren zweite
umfassende Abhandlung und Revision erlaubt auch anhand von einigen in
den letzten Jahrzehnten gefundenen Stücken die Rekonstruktion des
Schädels und die genauere Beschreibung diverser postkranialer
Elemente. Nach der allgemeinen Dokumentation der Exemplare,
Bemerkungen zur Geologie des Kupferschiefers sowie zur Taphonomie von
Protorosaurus und der Auswahl des Lectotypus gilt der Hauptteil der
Arbeit der Osteologie. Wichtige neue Stücke sind ein Teilskelett mit
vollständigem nahezu unverdrücktem Schädel und eine dorsale bis
caudale Wirbelsäule mit Gastralia, Becken und Hinterextremitäten von
dem bisher einzigen Exemplar eines juvenilen Individuums, jeweils aus
dem Richelsdorfer Revier, Hessen, und ferner das bis auf die
Schwanzspitze vollständige Skelett von Ibbenbüren, Nordrhein-
Westfalen. Auf der Grundlage der osteologischen Daten präsentieren
Verf. dann Vergleiche mit den inzwischen bekannten prolacertiformen
Taxa, das betrifft vor allem Prolacerta, Macrocnemus und
Pamelaria. Für die anschließende phylogenetische Analyse steht die
Frage der bislang recht unterschiedlichen Interpretation der
Prolacertiformes und Protorosauria im Vordergrund, da für beide
Protorosaurus ein Schlüsseltaxon ist. Ausgehend von der
paraphyletischen Interpretation der Prolacertiformes durch DILKES
(1998) nehmen Verf. im vorliegenden eine neue phylogenetische Analyse
vor, in der zahlreiche Merkmale revidiert sind und insgesamt 17 Taxa
nach 144 Merkmalen Berücksichtigung fi nden. Als Außentaxa fungieren
Petrolacosaurus und Araeoscelis und als terminale Innengruppen
Youngina bis Euparkeria + Proterosuchus. Aus der somit vergleichsweise
umfassenden phylogenetischen Analyse der frühen Archosauromorphen
resultiert folgende Topologie: Neodiapsida = [Youngina + Sauria
(Lepidosauromorpha + (Champsosaurus + Archosauromorpha))].
Protorosaurus erscheint sodann an der Basis der Archosauromorpha, und
das stellt sich in der vereinfachten dargestellten Topologie wie folgt
dar:
Archosauromorpha = [(Megalancosaurus + Protorosaurus) + (Tanystropheus
bis Prolacerta (Archosauriformes)].
Verf. weisen abschließend auf eine gewisse Instabilität des
Ergebnisses hin. Dieses hängt von der nur durch zwei unsichere
Merkmale begründeten Beziehung von Protorosaurus zu dem
Drepanosauriden Megalancosaurus ab. Bei Ausschluss von letzterem liegt
Protorosaurus in einer Trichotomie mit Tanystropheus und Macrocnemus,
und die Chorsitodera (Champsosaurus usw.) fallen dann nicht mehr unter
die Sauria, sondern sind nach Youngina lediglich deren
Schwestergruppe. Aber selbst in diesem Falle erweist sich
Protorosaurus als basaler und der geologisch älteste
Archosauromorphe. In Anhängen listen Verf. die Maße aller identifi
zierbaren Elemente der untersuchten Exemplare sowie die Merkmale und
deren Status im Rahmen der phylogenetischen Analyse auf.
Bei der Herkunft des untersuchten Materials stehen neuere Haldenfunde
aus dem Richelsdorfer Gebirge zahlenmäßig an erster Stelle. Es folgen
die klassischen Exemplare aus der Umrandung des Thüringer Waldes mit
Fundorten wie Schweina, Suhl, Glücksbrunn und Kupfersuhl [Man vermisst
Nachweise aus dem Mansfelder Revier. Diese Herkunft ist entweder auf
den Sammlungsstücken bzw. den Etiketten nicht vermerkt, bzw. wurde im
Falle von „Rothenburg an der Saale“ von den Verf. irrtümlich nach
Thüringen verlegt.].
H. HAUBOLD
Zentralblatt Geol. Pal. T. II Jg. 2009/5-6